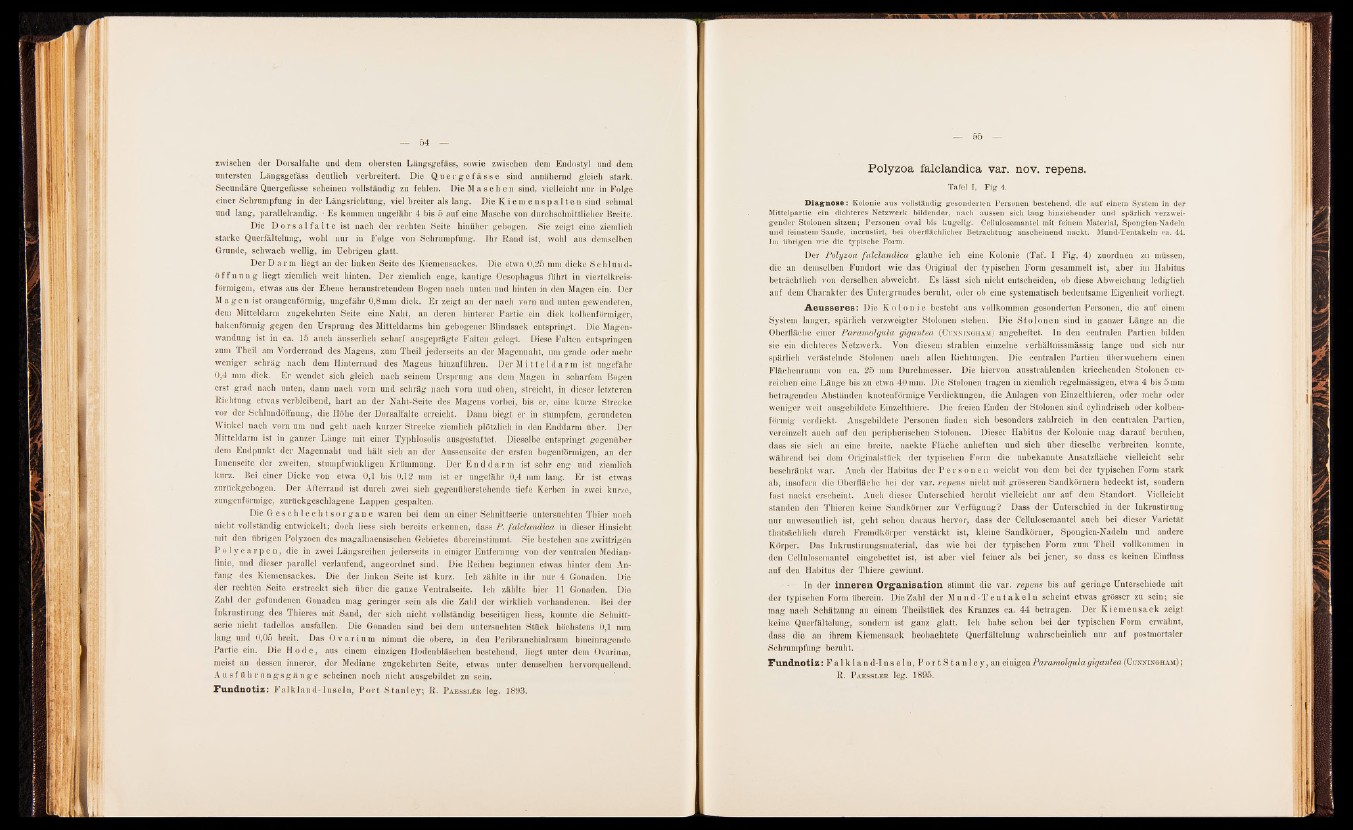
zwischen der Dorsalfalte und dem obersten Längsgefäss, sowie zwischen dem Endostyl und dem
untersten Längsgefäss deutlich verbreitert. Die Qu e r g e f ä s s e sind annähernd gleich stark.
Secundäre Quergefässe scheinen vollständig zu fehlen. Die Masch en sind, vielleicht nur in Folge
einer Schrumpfung in der Längsrichtung, viel breiter als lang. Die Ki eme n s p a l t e n sind schmal
und lang, parallelrandig. Es kommen ungefähr 4 bis 5 auf eine Masche von durchschnittlicher Breite.
Die Do r s a l f a l t e ist nach der rechten Seite hinüber gebogen. Sie zeigt eine ziemlich
starke Querfältelung, wohl nur in Folge von Schrumpfung. Ihr Rand ist, wohl aus demselben
Grunde, schwach wellig, im Uebrigen glatt.
Der Darm liegt an der linken Seite des Kiemensackes. Die etwa 0,25 mm dicke Schlundö
f f n u n g liegt ziemlich weit hinten. Der ziemlich enge, kantige Oesophagus führt in viertelkreisförmigen),
etwas aus der Ebene heraustretendem Bogen nach unten und hinten in den Magen ein. Der
M a g e n ist orangenförmig, ungefähr 0,8 mm dick. Er zeigt an der nach vorn und unten gewendeten,
dem Mitteldarm zugekehrten Seite eine Naht, an deren hinterer Partie ein dick kolbenförmiger,
hakenförmig gegen den Ursprung des Mitteldarms hin gebogener Blindsack entspringt. Die Magenwandung
ist in ca. 15 auch äusserlich scharf ausgeprägte Falten gelegt. Diese Falten entspringen
zum Theil am Vorderrand des Magens, zum Theil jederseits an der Magennaht, um grade oder mehr
weniger schräg nach dem Hinterrand des Magens hinzuführen. Der M i 11 e 1 d a r m ist ungefähr
0,4 mm dick. Er wendet sich gleich nach seinem Ursprung aus dem Magen in scharfem Bogen
erst grad nach unten, dann nach vorn und schräg nach vorn und oben, streicht, in dieser letzteren
Richtung etwas verbleibend, hart an der Naht-Seite des Magens vorbei, bis er, eine kurze Strecke
vor der Schlundöffnung, die Höhe der Dorsalfalte erreicht. Dann biegt er in stumpfem, gerundeten
Winkel nach vorn um und geht nach kurzer Strecke ziemlich plötzlich in den Enddarm über. Der
Mitteldarm ist in ganzer Länge mit einer Typhlosolis ausgestattet. Dieselbe entspringt gegenüber
dem Endpunkt der Magennaht und hält sich an der Aussenseite der ersten bogenförmigen, an der
Innenseite der zweiten, stumpfwinkligen Krümmung. Der En d d a rm ist sehr eng und ziemlich
kurz. Bei einer Dicke von etwa 0,1 bis 0,12 mm ist er ungefähr 0,4 mm lang. Er ist etwas
zurückgebogen. Der Afterrand ist durch zwei sich gegeuüberstehende tiefe Kerben in zwei kurze,
zungenförmige, zurückgeschlagene Lappen gespalten.
Die Ge s c h l e c h t s o r g a n e waren bei dem an einer Schnittserie untersuchten Thier noch
nicht vollständig entwickelt; doch liess sich bereits erkennen, dass P. falclandica in dieser Hinsicht
mit den übrigen Polyzoen des magalhaensischen Gebietes übereinstimmt. Sie bestehen aus zwittrigen
P o 1 y c a r p e n, die in zwei Längsreihen jederseits in einiger Entfernung von der ventralen Medianlinie,
und dieser parallel verlaufend, angeordnet sind. Die Reihen beginnen etwas hinter dem Anfang
des Kiemensaekes. Die der linken Seite ist kurz. Ich zählte in ihr nur 4 Gonaden. Die
der rechten Seite erstreckt sich über die ganze Ventralseite. Ich zählte hier 11 Gonaden. Die
Zahl der gefundenen Gonaden mag geringer sein als die Zahl der wirklich vorhandenen. Bei der
Inkrustirung des Tbieres mit Sand, der sich nicht vollständig beseitigen liess, konnte die Schnittserie
nicht tadellos ausfallen. Die Gonaden sind bei dem untersuchten Stück höchstens 0,1 mm
lang und 0,05 breit. Das 0 v a r i um nimmt die obere, in den Peribranchialraum hineinragende
Partie ein. Die H o d e , aus einem einzigen Hodenbläschen bestehend, liegt unter dem Ovarium,
meist an dessen innerer, der Mediane zugekehrten Seite, etwas unter demselben hervorquellend.
A u s f ü h r u n g s g ä n g e scheinen noch nicht ausgebildet zu sein.
F u n d n o tiz : Falkland-Inseln, Port Stanley; R. P aessl6r leg. 1893.
Polyzoa falclandica var. nov. repens.
Tafel I, F ig 4.
Diagnose: Kolonie aus vollständig geson d erten Personen bestehend, d ie a u f einem System in der
Mittelpartie ein dichteres Netzwerk bildender, nach aussen sich la n g hinziehender und spärlich v erzweig
en d e r Stolonen sitz en ; P er sonen o v a l b is k u g e lig . Cellulosemantel mit feinem Material, Spongien-Nadeln
u nd feinstem Sande, incrustirt, bei oberflächlicher Betrachtung anscheinend nackt. Mund-Tentakeln ca. 44.
Im übr igen w ie die typische Form.
Der Polyzoa falclandica glaube ich eine Kolonie (Taf. I Fig. 4) zuordnen zu müssen,
die an demselben Fundort wie das Original der typischen Form gesammelt ist, aber im Habitus
beträchtlich von derselben abweicht. Es lässt sich nicht entscheiden, ob diese Abweichung lediglich
auf dem Charakter des Untergrundes beruht, oder ob eine systematisch bedeutsame Eigenheit vorliegt.
A e u s s e re s : Die Ko lo n i e besteht aus vollkommen gesonderten Personen, die auf einem
System langer, spärlich verzweigter Stolonen stehen. Die Stolonen sind in ganzer Länge an die
Oberfläche einer Paramolgula gigantea (Cunningham) angeheftet. In den centralen Partien bilden
sie ein dichteres Netzwerk. Von diesem strahlen einzelne verhältnissmässig lange und sich nur
spärlich verästelnde Stolonen nach allen Richtungen. Die centralen Partien überwuchern einen
Flächenraum von ca. 25 mm Durchmesser. Die hiervon ausstrahlenden kriechenden Stolonen erreichen
eine Länge bis zu etwa 40 mm. Die Stolonen tragen in ziemlich regelmässigen, etwa 4 bis 5mm
betragenden Abständen knotenförmige Verdickungen, die Anlagen von Einzelthieren, oder mehr oder
weniger weit ausgebildete Einzelthiere. Die freien Enden der Stolonen sind cylindrisch oder kolbenförmig
verdickt. Ausgebildete Personen finden sich besonders zahlreich in den centralen Partien,
vereinzelt auch auf den peripherischen Stolonen. Dieser Habitus der Kolonie mag darauf beruhen,
dass sie sich an eine breite, nackte Fläche anheften und sich über dieselbe verbreiten konnte,
während bei dem Originalstück der typischen Form die unbekannte Ansatzfläche vielleicht sehr
beschränkt war. Auch der Habitus der P e r s o n e n weicht von dem bei der typischen Form stark
ab, insofern die Oberfläche bei der var. repens nicht mit grösseren Sandkörnern bedeckt ist, sondern
fast nackt erscheint. Auch dieser Unterschied beruht vielleicht nur auf dem Standort. Vielleicht
standen den Thieren keine Sandkörner zur Verfügung? Dass der Unterschied in der Inkrustirung
nur unwesentlich ist, geht schon daraus hervor, dass der Cellulosemantel auch bei dieser Varietät
thatsächlich durch Fremdkörper verstärkt ist, kleine Sandkörner, Spongien-Nadeln und andere
Körper. Das Inkrustirungsmaterial, das wie bei der typischen Form zum Theil vollkommen in
den Cellulosemantel eingebettet ist, ist aber viel feiner als bei jener, so dass es keinen Einfluss
auf den Habitus der Thiere gewinnt.
In der in n e ren O rg a n isa tio n stimmt die var. repens bis auf geringe Unterschiede mit
der typischen Form überein. Die Zahl der Mu n d -Te n t a k e l n scheint etwas grösser zu sein; sie
mag nach Schätzung an einem Theilstück des Kranzes ca. 44 betragen. Der Kiemensack zeigt
keine Querfältelung, sondern ist ganz glatt. Ich habe schon bei der typischen Form erwähnt,
dass die an ihrem Kiemensack beobachtete Querfältelung wahrscheinlich nur auf postmortaler
Schrumpfung beruht.
F u n d n o tiz :F a l k l a n d - I n s e l n ,P o r tS t a n l e y , a n einigen Paramolgula gigantea (Cunningham) ;
R. P aessler leg. 1895.