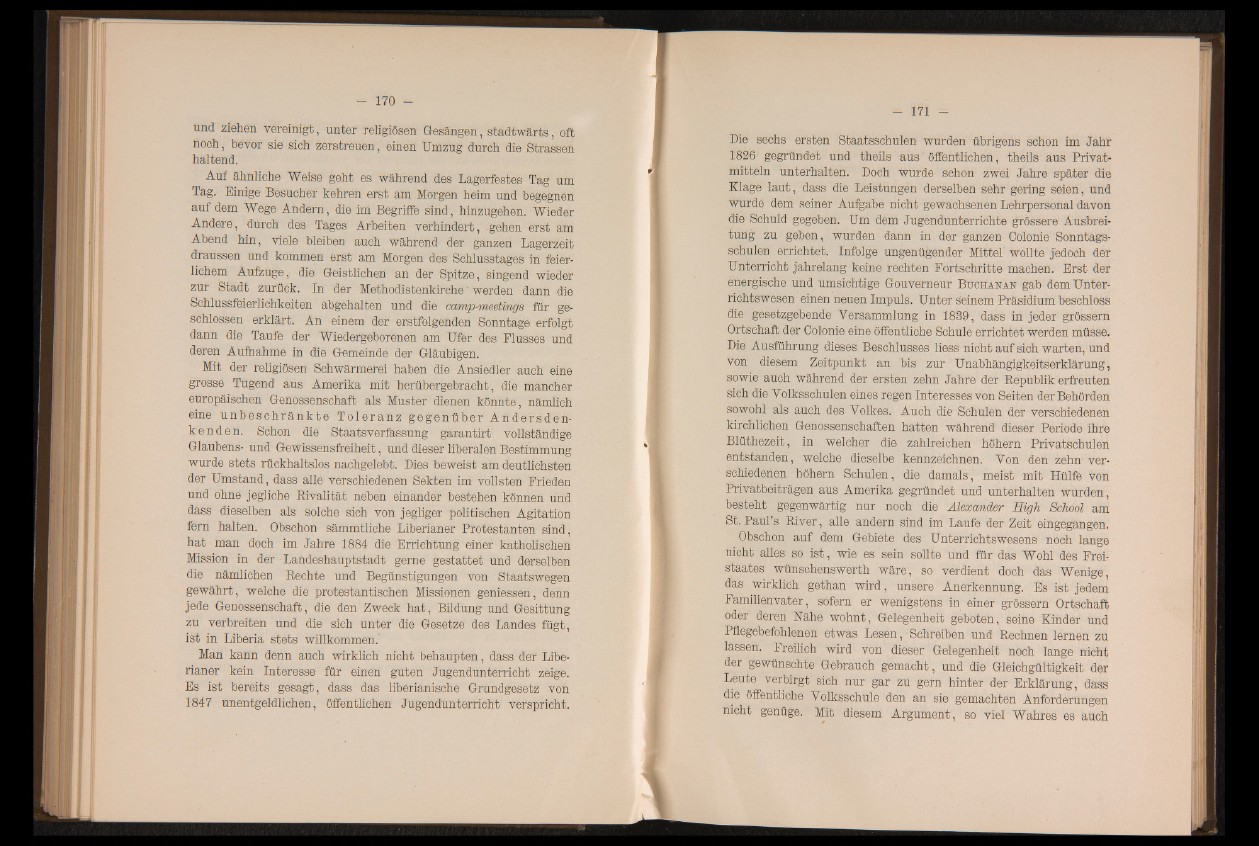
und ziehen vereinigt, unter religiösen Gesängen, stadtwärts, oft
noch, bevor sie sich zerstreuen, einen Umzug durch die Strassen
haltend.
Auf ähnliche Weise geht es während des Lagerfestes Tag um
Tag. Einige Besucher kehren erst am Morgen heim und begegnen
auf dem Wege Ändern, die im Begriffe sind, hinzugehen. Wieder
Andere, durch des Tages Arbeiten verhindert, .gehen erst am
Abend hin, viele bleiben auch während der ganzen Lagerzeit
draussen und kommen erst am Morgen des Schlusstages in feierlichem
Aufzuge, die Geistlichen an der Spitze, singend wieder
zur Stadt zurück. In der Methodistenkirche' werden dann die
Schlussfeierlichkeiten abgehalten und die camp-meetings für geschlossen
erklärt. An einem der erstfolgenden Sonntage erfolgt
dann die Taufe der Wiedergeborenen am Ufer des Flusses und
deren Aufnahme in die Gemeinde der Gläubigen.
Mit der religiösen Schwärmerei haben die Ansiedler auch eine
grosse Tugend aus Amerika mit herübergebracht, die mancher
europäischen Genossenschaft als Muster dienen könnte, nämlich
eine u n b e s c h r ä n k t e To l e r a n z g eg e n ü h e r An d e r s d e n kenden.
Schon die Staatsverfassung garantirt vollständige
Glaubens- und Gewissensfreiheit, und dieser liberalen Bestimmung
wurde stets rückhaltslos nachgelebt. Dies beweist am deutlichsten
der Umstand, dass alle verschiedenen Sekten im vollsten Frieden
und ohne jegliche Rivalität neben einander bestehen können und
dass dieselben als solche sich von jegliger politischen Agitation
fern halten. Obschon sämmtliche Liberianer Protestanten sind,
hat man doch im Jahre 1884 die Errichtung einer katholischen
Mission in der Landeshauptstadt gerne gestattet und derselben
die nämlichen Rechte und Begünstigungen von Staatswegen
gewährt, welche die protestantischen Missionen geniessen, denn
jede Genossenschaft, die den Zweck h at, Bildung und Gesittung
zu verbreiten und die sich unter die Gesetze des Landes fügt,
ist in Liberia stets willkommen.
Man kann denn auch wirklich nicht behaupten, dass der Liberianer
kein Interesse für einen guten Jugendunterricht zeige.
Es ist bereits gesagt, dass das liberianische Grundgesetz von
1847 unentgeldlichen, öffentlichen Jugendunterricht verspricht.
Die sechs ersten Staatsschulen wurden übrigens schon im Jahr
1826 gegründet und theils au s' öffentlichen, theils aus Privatmitteln
unterhalten. Doch wurde schon zwei Jahre später die
Klage laut, dass die Leistungen derselben sehr gering seien, und
wurde dem seiner Aufgabe nicht gewachsenen Lehrpersonal davon
die Schuld gegeben. Um dem Jugendunterrichte grössere Ausbreitung
zu geben, wurden dann in der ganzen Colonie Sonntagsschulen
errichtet. Infolge ungenügender Mittel wollte jedoch der
Unterricht jahrelang keine rechten Fortschritte machen. Erst der
energische und umsichtige Gouverneur B ucha man gab dem Unterrichtswesen
einen neuen Impuls. Unter seinem Präsidium beschloss
die gesetzgebende Versammlung in 1839, dass in jeder grössern
Ortschaft der Colonie eine öffentliche Schule errichtet werden müsse.
Die Ausführung dieses Beschlusses liess nicht auf sich warten, und
von diesem Zeitpunkt an bis zur Unabhängigkeitserklärung,
sowie auch während der ersten zehn Jahre der Republik erfreuten
sich die Volksschulen eines regen Interesses von Seiten der Behörden
sowohl als auch des Volkes. Auch die Schulen der verschiedenen
kirchlichen Genossenschaften hatten während dieser Periode ihre
Blüthezeit, in welcher die zahlreichen höhern Privatschulen
entstanden, welche dieselbe kennzeichnen. Von den zehn1 verschiedenen
höhern Schulen, die damals, meist mit Hülfe von
Privatbeiträgen aus Amerika gegründet und unterhalten wurden,
besteht gegenwärtig nur noch die Alexander High School am
St. Paul’s River, alle ändern sind im Laufe der Zeit eingegangen.
Obschon auf dem Gebiete des Unterrichtswesens noch lange
nicht alles so i s t , wie es sein sollte und für das Wohl des Freistaates
wünschenswerth wäre, so verdient doch das Wenige,
das wirklich gethan wird, unsere Anerkennung. Es ist jedem
Familienväter, sofern er wenigstens in einer grössern Ortschaft
oder deren Nähe wohnt, Gelegenheit geboten, seine Kinder und
Pflegebefohlenen etwas Lesen, Schreiben und Rechnen lernen zu
lassen. Freilich wird von dieser Gelegenheit noch lange nicht
der gewünschte Gebrauch gemacht, und die Gleichgültigkeit der
Leute verbirgt sich nur gar zu gern hinter der Erklärung, dass
die öffentliche Volksschule den an sie gemachten Anforderungen
nicht genüge. Mit diesem Argument, so viel Wahres es auch