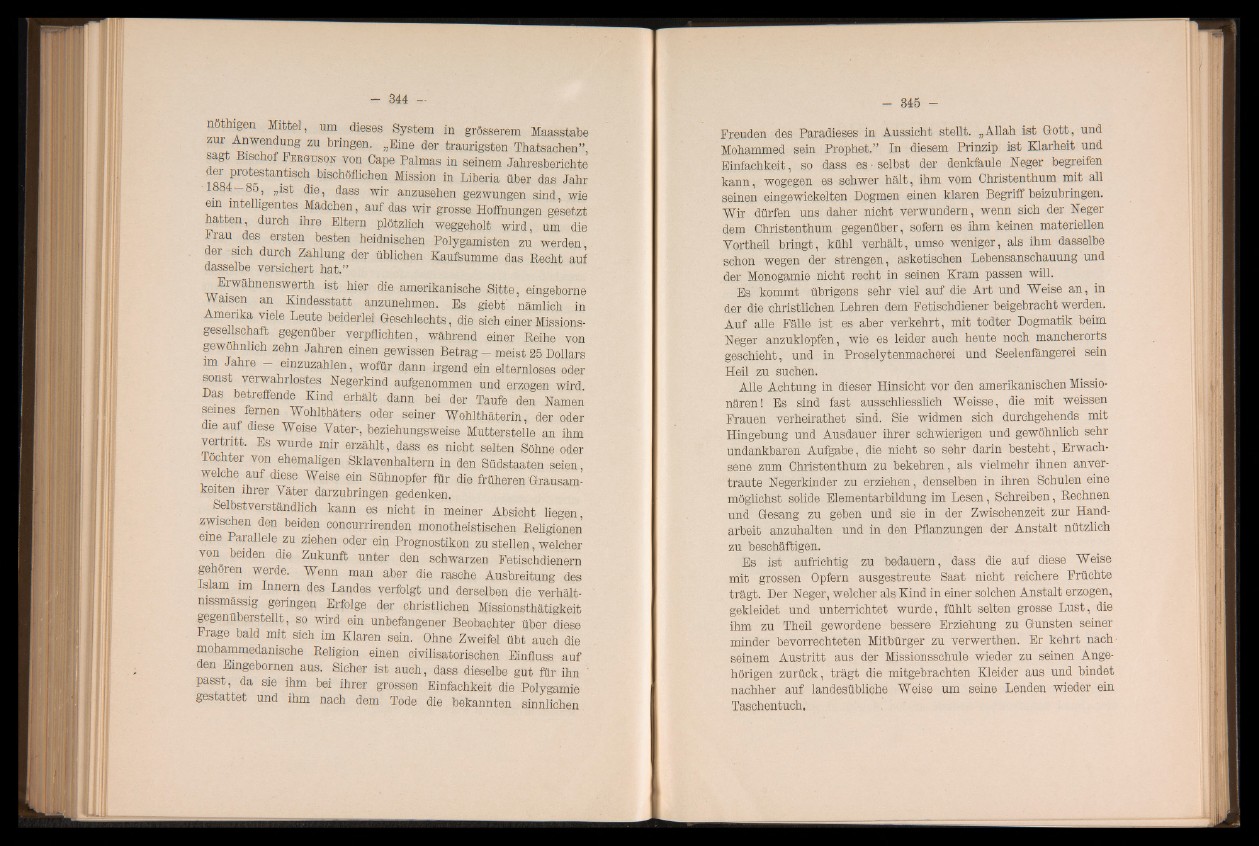
öthigen Mittel, um dieses System in grösserem Maasstabe
zur Anwendung zu bringen. „Eine der traurigsten Thatsachen”,
sagt Bischof Ferguson von Cape Palmas in seinem Jahresberichte
i ssiPr° i StantlSCb-blschöflichen Mission in Liberia über das Jahr
85, „ist die, dass wir anzusehen gezwungen sind, wie
ein intelligentes Mädchen, auf das wir grosse Hoffnungen gesetzt
hatten, durch ihre Eltern plötzlich weggeholt wird, um die
tra u des ersten besten heidnischen Polygamisten zu werden
der sich durch Zahlung der üblichen Kaufsumme das Recht auf
dasselbe versichert hat.”
Erwähnenswerth ist hier die amerikanische Sitte, eingeborne
Waisen an Kindesstatt anzunehmen. Es giebt' nämlich in
Amerika viele Leute beiderlei Geschlechts, die sich einer Missionsgesellschaft
gegenüber verpflichten, während einer Reihe von
gewöhnlich zehn Jahren einen gewissen Betrag — meist 25 Dollars
im Jahre — einzuzahlen, wofür dann irgend ein elternloses oder
sonst verwahrlostes Negerkind aufgenommen und erzogen wird.
Das betreffende Kind erhält dann bei der Taufe den Namen
seines fernen Wohlthäters oder seiner Wohlthäterin, der oder
die auf diese Weise Vater-, beziehungsweise Mutterstelle an ihm
vertritt. Es wurde mir erzählt, dass es nicht selten Söhne oder
löchter von ehemaligen Sklavenhaltern in den Südstaaten seien,
welche auf diese Weise ein Sühnopfer flir die früheren Grausamkeiten
ihrer Väter darzubringen gedenken.
Selbstverständlich kann es nicht in meiner Absicht liegen,
zwischen den beiden concurrirenden monotheistischen Religionen
eine Parallele zu ziehen oder ein Prognostikon zu stellen, welcher
von beiden die Zukunft unter den schwarzen Fetischdienern
gehören werde. Wenn man aber die rasche Ausbreitung des
slam im Innern des Landes verfolgt und derselben die verhältnismässig
geringen Erfolge der christlichen Missionsthätigkeit
gegenüherstellt, so wird ein unbefangener Beobachter über diese
Frage bald mit sich im Klaren sein. Ohne Zweifel übt auch die
mohammedanische Religion einen civilisatorischen Einfluss auf
den Eingebornen aus. Sicher ist auch, dass dieselbe gut für ihn '
passt, da sie ihm bei ihrer grossen Einfachkeit die Polygamie
gestattet und ihm nach dem Tode die bekannten sinnlichen
Freuden des Paradieses in Aussicht stellt. „Allah ist Gott, und
Mohammed sein Prophet.” In diesem Prinzip ist Klarheit und
Einfachkeit, so dass es-selbst der denkfaule Neger begreifen
kann, wogegen es schwer hält, ihm vom Christenthum mit all
seinen eingewickelten Dogmen einen klaren Begriff beizubringen.
Wir dürfen uns daher nicht verwundern, wenn sich der Neger
dem Christenthum gegenüber, sofern es ihm keinen materiellen
Vortheil bringt, kühl verhält, umso weniger, als ihm dasselbe
schon wegen der strengen, asketischen Lehensanschauung und
der Monogamie nicht recht in seinen Kram passen will.
Es kommt übrigens sehr viel auf die Art und Weise an, in
der die christlichen Lehren dem Fetischdiener beigebracht werden.
Auf alle Fälle ist es aber verkehrt, mit todter Dogmatik beim
Neger anzuklopfen , wie es leider auch heute noch mancherorts
geschieht, und in Proselytenmacherei und Seelenfängerei sein
Heil zn suchen.
Alle Achtung in dieser Hinsicht vor den amerikanischen Missionären!
Es sind fast ausschliesslich Weisse, die mit weissen
Frauen verheirathet sind. Sie widmen sich durchgehends mit
Hingebung und Ausdauer ihrer schwierigen und gewöhnlich sehr
undankbaren Aufgabe, die nicht so sehr darin besteht, Erwachsene
zum Christenthum zu bekehren, als vielmehr ihnen anvertraute
Negerkinder zu erziehen, denselben in ihren Schulen eine
möglichst solide Elementarbildung im Lesen, Schreiben, Rechnen
und Gesang zu gehen und sie in der Zwischenzeit zur Handarbeit
anzuhalten und in den Pflanzungen der Anstalt nützlich
zu beschäftigen.
Es ist aufrichtig zu bedauern, dass die auf diese Weise
mit grossen Opfern ausgestreute Saat nicht reichere Früchte
trägt. Der Neger, welcher als Kind in einer solchen Anstalt erzogen,
gekleidet und unterrichtet wurde, fühlt selten grosse Lust, die
ihm zu Theil gewordene bessere Erziehung zu Gunsten seiner
minder bevorrechteten Mitbürger zu verwerthen. Er kehrt nach
seinem Austritt aus der Missionsschule wieder zu seinen Angehörigen
zurück, trägt die mitgebrachten Kleider aus und bindet
nachher auf landesübliche Weise um seine Lenden wieder ein
Taschentuch,