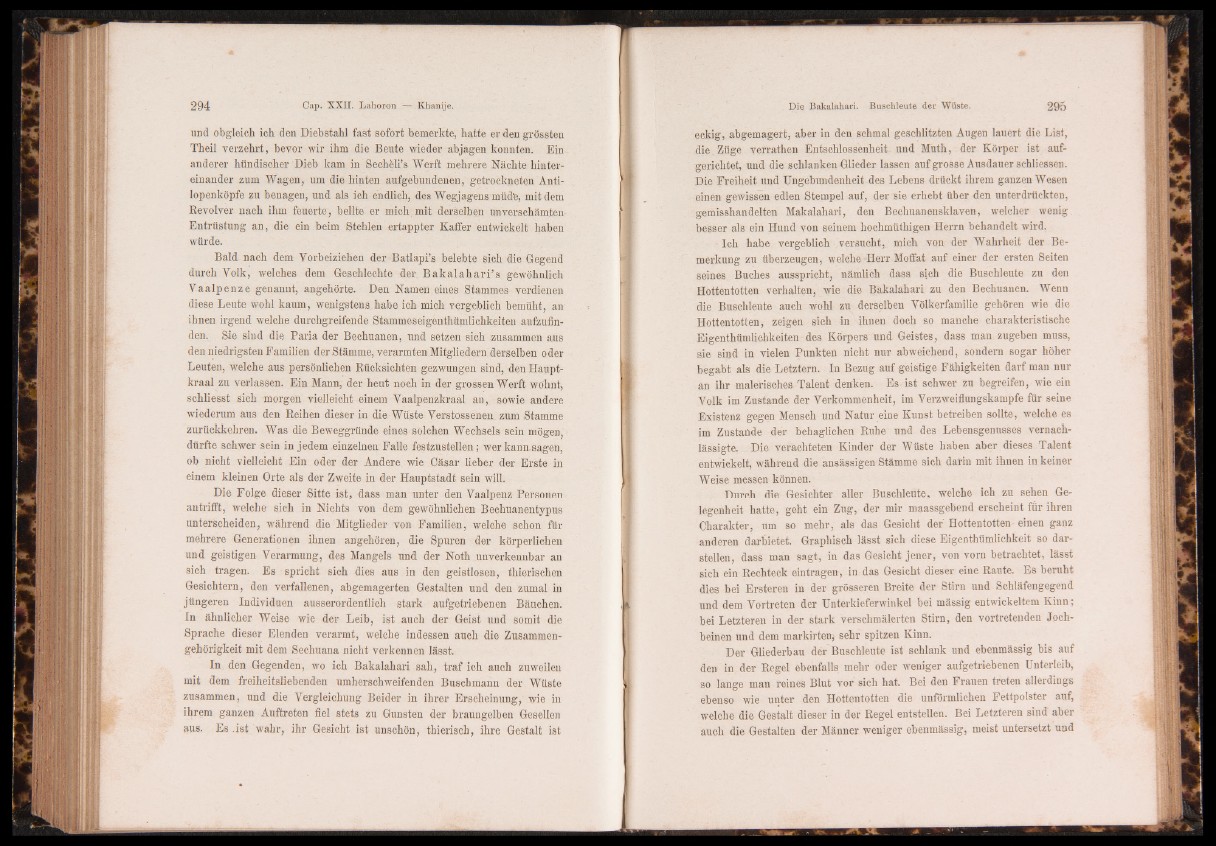
und obgleich ich den Diebstahl fast sofort bemerkte, hatte er den grössten
Theil verzehrt, bevor wir ihm die Beute wieder abjagen konnten. Ein
anderer hündischer Dieb kam in Sechöli’s Werft mehrere Nächte hintereinander
zum Wagen, um die hinten aufgebundenen, getrockneten Antilopenköpfe
zu benagen, und als ich endlich, des Wegjagens müde, mit dem
Revolver nach ihm feuerte, bellte er mich mit derselben unverschämten
Entrüstung an, die ein beim Stehlen ertappter Kaffer entwickelt haben
würde.
Bald nach dem Vorbeiziehen der Batlapi’s belebte sich die Gegend
durch Volk, welches dem Geschlechte der B a k a la h a r i ’s gewöhnlich
V a a lp en z e genannt, angehörte. Den Namen eines Stammes verdienen
diese Leute wohl kaum, wenigstens habe ich mich vergeblich bemüht, an
ihnen irgend welche durchgreifende Stammeseigenthümlichkeiten aufzufinden.
Sie sind die Paria der Bechuanen, und setzen sich zusammen aus
den niedrigsten Familien der Stämme, verarmten Mitgliedern derselben oder
Leuten, welche aus persönlichen Rücksichten gezwungen sind, den Hauptkraal
zu verlassen. Ein Mann, der heut noch in der grossen Werft wohnt,
schliesst sich morgen vielleicht einem Vaalpenzkraal an, sowie andere
wiederum aus den Reihen dieser in die Wüste Verstossenen zum Stamme
zurückkehren. Was die Beweggründe eines solchen Wechsels sein mögen,
dürfte schwer sein in jedem einzelnen Falle festzustellen; wer kann, sagen,
ob nicht vielleicht Ein oder der Andere wie Cäsar lieber der Erste in
einem kleinen Orte als der Zweite in der Hauptstadt sein will.
Die Folge dieser Sitte ist, dass man unter den Vaalpenz Personen
an trifft, welche sich in Nichts von dem gewöhnlichen Bechuanentypus
unterscheiden, während die Mitglieder von Familien, welche schon für
mehrere Generationen ihnen angehören, die Spuren der körperlichen
und geistigen Verarmung, des Mangels und der Noth unverkennbar an
sich tragen. Es spricht sich dies aus in den geistlosen, thierischen
Gesichtern, den verfallenen, abgemagerten Gestalten und den zumal in
jüngeren Individuen ausserordentlich stark aufgetriebenen Bäuchen.
In ähnlicher Weise wie der Leib, ist auch der Geist und somit die
Sprache dieser Elenden verarmt, welche indessen auch die Zusammengehörigkeit
mit dem Sechuana nicht verkennen lässt.
In den Gegenden, wo ich Bakalahari sah, traf ich auch zuweilen
mit dem freiheitsliebenden umherschweifenden Buschmann der Wüste
zusammen, und die Vergleichung Beider in ihrer Erscheinung, wie in
ihrem ganzen Auftreten fiel stets zu Gunsten der braungelben Gesellen
aus. Es ist wahr, ihr Gesicht ist unschön, thierisch, ihre Gestalt ist
eckig, abgemagert, aber in den schmal geschlitzten Augen lauert die List,
die Züge verrathen Entschlossenheit und Muth, der Körper ist aufgerichtet,
und die schlanken Glieder lassen auf grosse Ausdauer schliessen.
Die Freiheit und Ungebundenheit des Lebens drückt ihrem ganzen Wesen
einen gewissen edlen Stempel auf, der sie erhebt über den unterdrückten,
gemisshandelten Makalahari, den Bechuanensklaven, welcher wenig,
besser als ein Hund von seinem hochmüthigen Herrn behandelt wird.
Ich habe vergeblich versucht, mich von der Wahrheit der Bemerkung
zu überzeugen, welche Herr Moffat auf einer der ersten Seiten
seines Buches ausspricht, nämlich dass sich die Buschleute zu den
Hottentotten verhalten, wie die Bakalahari zu den Bechuanen. Wenn
die Buschleute auch wohl zu derselben Völkerfamilie gehören wie die
Hottentotten, zeigen sich in ihnen doch so manche charakteristische
Eigenthümlichkeiten des Körpers und Geistes, dass man zugeben muss,
sie sind in vielen Punkten nicht nur abweichend, sondern sogar höher
begabt als die Letztem. In Bezug auf geistige Fähigkeiten darf man nur
an ihr malerisches Talent denken. Es ist schwer zu begreifen, wie ein
Volk im Zustande der Verkommenheit, im Verzweiflungskampfe für seine
Existenz gegen Mensch und Natur eine Kunst betreiben sollte, welche es
im Zustande der behaglichen Ruhe und des Lebensgenusses vernachlässigte.
Die verachteten Kinder der Wüste haben aber dieses Talent
entwickelt, während die ansässigen Stämme sich darin mit ihnen in keiner
Weise messen können.
Durch die Gesichter aller Buschleute, welche ich zu sehen Gelegenheit
hatte, geht ein Zug, der mir maassgebend erscheint für ihren
Charakter, um so mehr, als das Gesicht der'Hottentotten einen ganz
anderen darbietet. Graphisch lässt sich diese Eigenthümlichkeit so darstellen,
dass man sagt, in das Gesicht jener, von vorn betrachtet, lässt
sich ein Rechteck eintragen, in das Gesicht dieser eine Raute. Es beruht
dies bei Ersteren in der grösseren Breite der Stirn und Schläfengegend
und dem Vortreten der Unterkieferwinkel bei mässig entwickeltem Kinn;
bei Letzteren in der stark verschmälerten Stirn, den vortretenden Jochbeinen
und dem markirten, sehr spitzen Kinn.
Der Gliederbau der Buschleute ist schlank und ebenmässig bis auf
den in der Regel ebenfalls mehr oder weniger aufgetriebenen Unterleib,
so lange man reines Blut vor sich hat. Bei den Frauen treten allerdings
ebenso wie unter den Hottentotten die unförmlichen Fettpolster auf,
welche die Gestalt dieser in der Regel entstellen. Bei Letzteren sind aber
auch die Gestalten der Männer weniger ebenmässig, meist untersetzt und