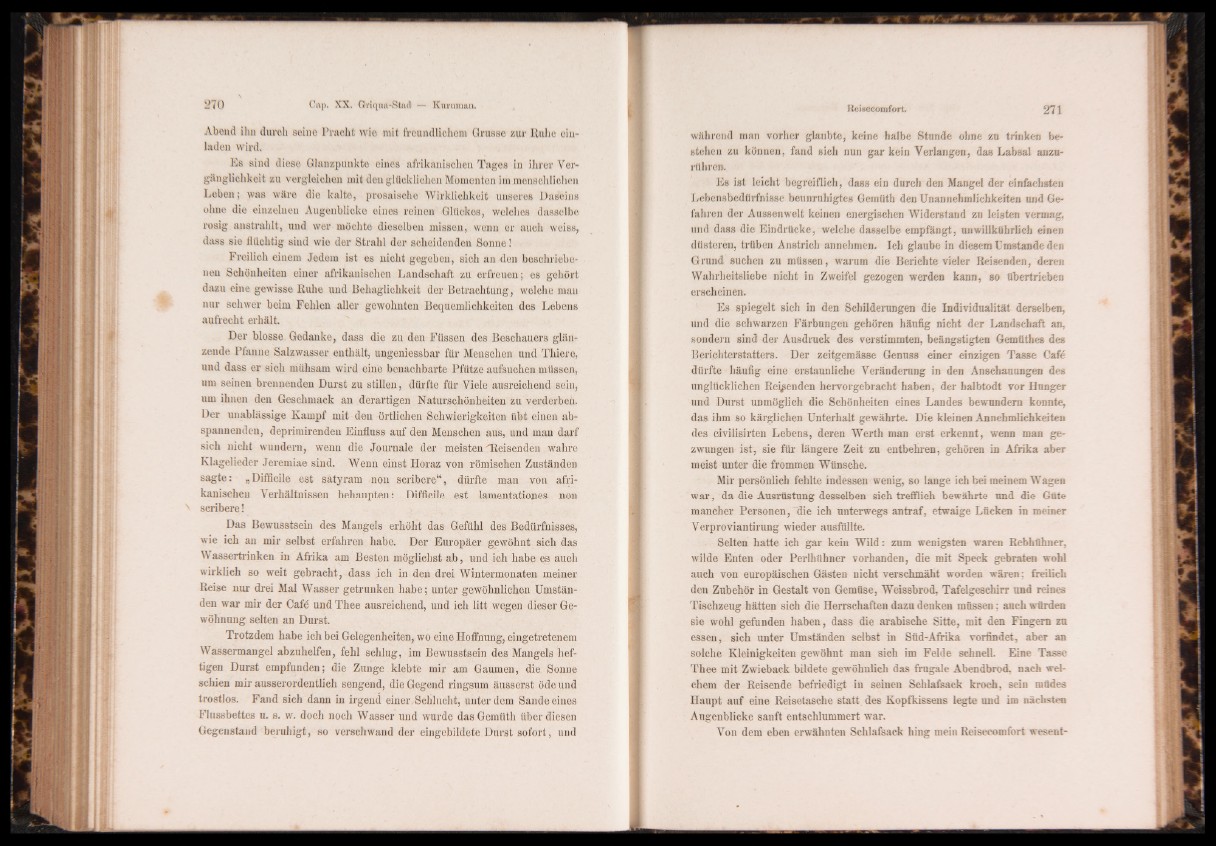
Abond ihn durch seine Pracht wie mit freundlichem Gritóse zur Ruhe cin-
ladeu wird.
Es sind diese Glanzpunkte eines afrikanischen Tages in ihrer Vergänglichkeit
zu vergleichen mit den glücklichen Momenten im menschlichen
Leben; was wäre die kalte, prosaische Wirklichkeit unseres Daseins
ohne die einzelnen Augenblicke eines reinen Glüekos, welches dasselbe
rosig anstrahlt, und wer möchte dieselben missen, wenn er auch weiss,
dass sie flüchtig sind wie der Strahl der scheidenden Sonne!
Freilich einem Jedem ist es nicht gegeben, sich an den beschriebenen
Schönheiten einer afrikanischen Landschaft zu erfreuen; es gehört
dazu eine gewisse Ruhe und Behaglichkeit der Betrachtung, welche man
nur schwer beim Fehlen aller gewohnten Bequemlichkeiten des Lebens
aufrecht erhält.
Der blosse Gedanke, dass die zu den Füssen des Beschauers glänzende
Pfanne Salzwasser enthält, ungeniessbar für Menschen und Thiere,
und dass er sich mühsam wird eine benachbarte Pfütze aufsuchen müssen,
um seinen brennenden Durst zu stillen, dürfte für Viele ausreichend sein,
um ihnen den Geschmack an derartigen Naturschönheiten zu verderben.
Der unablässige Kampf mit den örtlichen Schwierigkeiten übt einen abspannenden,
deprimirenden Einfluss auf den Menschen aus, und man darf
sich nicht wundern, wenn die Journale der meisten ■'Reisenden wahre
Klagelieder Jeremiae sind. Wenn einst Horaz von römischen Zuständen
sagte: „Difficile est satyram non scribere“ , dürfte man von afrikanischen
Verhältnissen behaupten: Difficile est lamentatiopes non
scribere!
Das Bewusstsein des Mangels erhöht das Gefühl des Bedürfnisses,
wie ich an mir selbst erfahren habe. Der Europäer gewöhnt sich das
Wassertrinken in Afrika am Besten möglichst ab, und ich habe es auch
wirklich so weit gebracht, dass ich in den drei Wintermonaten meiner
Reise nur drei Mal Wasser getrunken habe; unter gewöhnlichen Umständen
war mir der Café und Thee ausreichend, und ich litt wegen dieser Gewöhnung
selten an Durst.
Trotzdem habe ich bei Gelegenheiten, wo eine Hoffnung, eingetretenem
Wassermangel abzuhelfen, fehl schlug, im Bewusstsein des Mangels heftigen
Durst empfunden; die Zunge klebte mir am Gaumen, die Sonne
schien mir ausserordentlich sengend, die Gegend ringsum äusserst öde und
trostlos. Fand sich dann in irgend einer Schlucht, unter dem Sande eines
Flussbettes u. s. w. doch noch Wasser und wurde dasGemüth über diesen
Gegenstand beruhigt, so verschwand der eingebildete Durst sofort, und
während man vorher glaubte, keine halbe Stunde ohne zu trinken bestehen
zu können, fand sich nun gar kein Verlangen, das Labsal anzu-
rühreu.
Es ist leicht begreiflich, dass ein durch den Mangel der einfachsten
Lebensbedürfnisse beunruhigtes Gernüth den Unannehmlichkeiten und Gefahren
der Aussenwelt keinen energischen Widerstand zu leisten vermag,
und dass die Eindrücke, welche dasselbe empfängt, unwillkübrlich einen
düsteren, trüben Anstrich annehmen. Ich glaube in diesem Umstande den
Grund suchen zu müssen, warum die Berichte vieler Reisenden, deren
Wahrheitsliebe nicht in Zweifel gezogen werden kann, so übertrieben
erscheinen.
Es spiegelt sich in den Schilderungen die Individualität derselben,
und die schwarzen Färbungen gehören häufig nicht der Landschaft an,
sondern sind der Ausdruck des verstimmten, beängstigten Gemüthes des
Berichterstatters. Der zeitgemässe Genuss einer einzigen Tasse Cafe
dürfte häufig eine erstaunliche Veränderung in den Anschauungen des
unglücklichen Redenden hervorgebracht haben, der balbtodt vor Hunger
und Durst unmöglich die Schönheiten eines Landes bewundern konnte,
das ihm so kärglichen Unterhalt gewährte. Die kleinen Annehmlichkeiten
des civilisirten Lebens, deren Werth man erst erkennt, wenn man gezwungen
ist, sie für längere Zeit zu entbehren, gehören in Afrika aber
meist unter die frommen Wünsche.
Mir persönlich fehlte indessen wenig, so lange ich bei meinem Wagen
wa r, da die Ausrüstung desselben sich trefflich bewährte und die Güte
mancher Personen, die ich unterwegs antraf, etwaige Lücken in meiner
Verproviantirung wieder ausfullte.
Selten hatte ich gar kein Wild: zum wenigsten waren Rebhühner,
wilde Enten oder Perlhühner vorhanden, die mit Speck gebraten wohl
auch von europäischen Gästen nicht verschmäht worden wären: freilich
den Zubehör in Gestalt von Gemüse, Weissbrod, Tafelgeschirr und reines
Tischzeug hätten sich die Herrschaften dazu denken müssen: auch würden
sie wohl gefunden haben, dass die arabische Sitte, mit den Fingern zu
essen, sich unter Umständen selbst in Süd-Afrika vorfindet, aber an
solche Kleinigkeiten gewöhnt man sich im Felde sehnell. Eine Tasse
Thee mit Zwieback bildete gewöhnlich das frugale Abendbrod. nach welchem
der Reisende befriedigt in seinen Schlafsack kroch, sein müdes
Haupt auf eine Reisetasche statt des Kopfkissens legte und im nächsten
Augenblicke sanft entschlummert war.
Von dem eben erwähnten Schlafsack hing mein Reisecomfort wesent