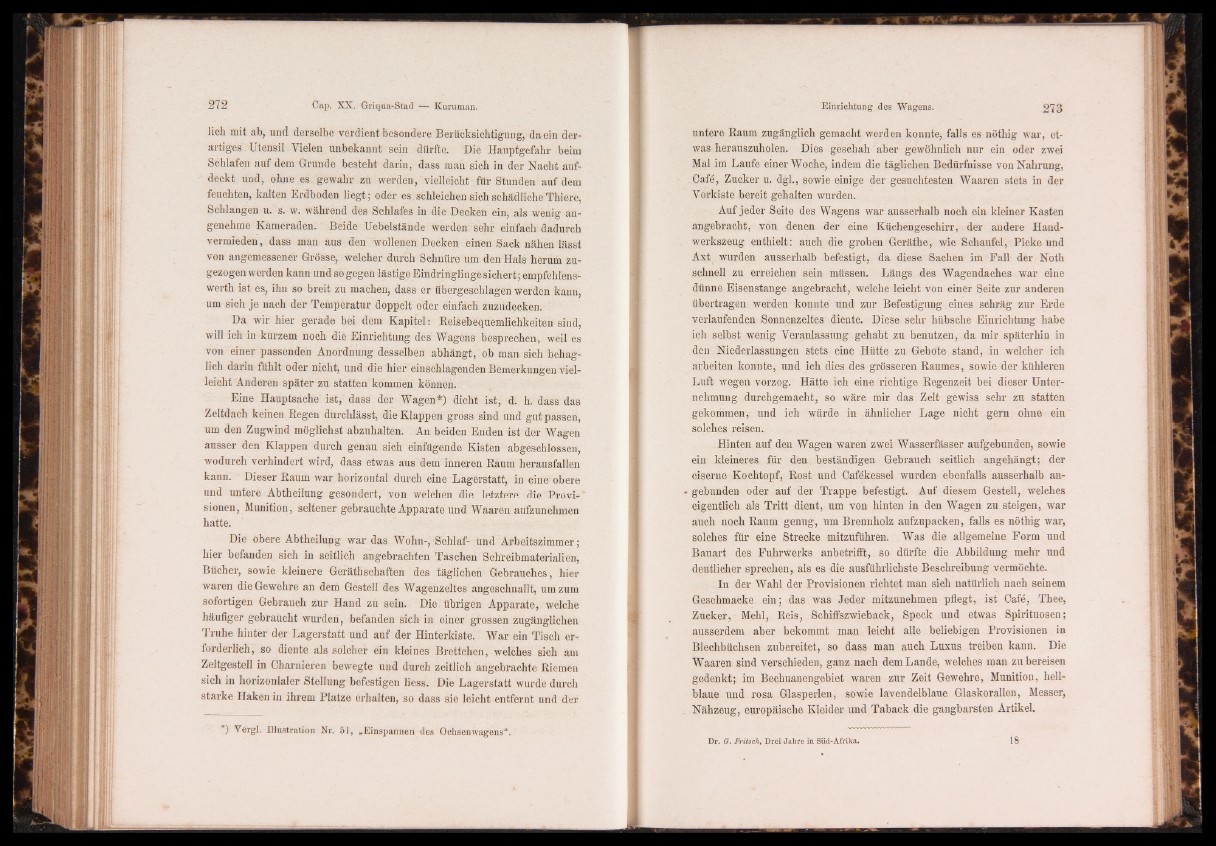
lieh mit ab, und derselbe verdient besondere Berücksichtigung, da ein derartiges
Utensil Vielen unbekannt sein dürfte. Die Hauptgefahr beim
Schlafen auf dem Grunde besteht darin, dass man sich in der Nacht aufdeckt
und, ohne es gewahr zu werden, vielleicht für Stunden auf dem
feuchten, kalten Erdboden liegt; oder es schleichen sich schädliche Thiere,
Schlangen u. s. w. während des Schlafes in die Decken ein, als wenig angenehme
Kameraden. Beide Uebelstände werden sehr einfach dadurch
vermieden, dass man aus den wollenen Decken einen Sack nähen lässt
von angemessener Grösse, welcher durch Schnüre um den Hals herum zugezogen
werden kann und so gegen lästige Eindringlingesichert; empfehlens-
werth ist es, ihn so breit zu machen, dass er übergeschlagen werden kann,
um sieh je nach der Temperatur doppelt oder einfach zuzudecken.
Da wir hier gerade bei dem Kapitel: Reisebequemliehkeiten sind,
will ich in kurzem noch die Einrichtung des Wagens besprechen, weil es
von einer passenden Anordnung desselben abhängt, ob man sich behaglich
darin fühlt oder nicht, und die hier einschlagenden Bemerkungen vielleicht
Anderen später zu statten kommen können.
Eine Hauptsache ist, dass der Wagen*) dicht ist, d. h. dass das
Zeltdach keinen Regen durchlässt, die Klappen gross sind und gut passen,
um den Zugwind möglichst abzuhalten. An beiden Enden ist der Wagen
ausser den Klappen durch genau sich einfügende Kisten abgeschlossen,
wodurch verhindert wird, dass etwas aus dem inneren Raum herausfallen
kann. Dieser Raum war horizontal durch eine Lagerstatt, in eine obere
und untere Abtheilung gesondert, von welchen die letztere die Provisionen,
Munition, seltener gebrauchte Apparate und Waaren aufzunehmen
hatte.
Die obere Abtheilupg war das Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer;
hier befanden sich in seitlich angebrachten Taschen Schreibmaterialien,
Bücher, sowie kleinere Gerätschaften des täglichen Gebrauches, hier
waren die Gewehre an dem Gestell des Wagenzeltes angeschnallt, um zum
sofortigen Gebrauch zur Hand zu sein. Die übrigen Apparate, welche
häufiger gebraucht wurden, befanden sich in einer grossen zugänglichen
Truhe hinter der Lagerstatt und auf der Hinterkiste. War ein Tisch erforderlich,
so diente als solcher ein kleines Brettchen, welches sich am
Zeltgestell in Charteren bewegte und durch zeitlich angebrachte Riemen
sich in horizonlaler Stellung befestigen liess. Die Lagerstatt wurde durch
starke Haken in ihrem Platze erhalten, so dass sie leicht entfernt und der
*) Vergl. Illustration Nr. 51, „Einspannen des Ochsenwagens“.
untere Raum zugänglich gemacht werden konnte, falls es nöthig war, etwas
herauszuholen. Dies geschah aber gewöhnlich nur ein oder zwei
Mal im Laufe einer Woche, indem die täglichen Bedürfnisse von Nahrung,
Café, Zucker u. dgl., sowie einige der gesuchtesten Waaren stets in der
Vorkiste bereit gehalten wurden.
Auf jeder Seite des Wagens war ausserhalb noch ein kleiner Kasten
angebracht, von denen der eine Küchengeschirr, der andere Handwerkszeug
enthielt: auch die groben Geräthe, wie Schaufel, Picke und
Axt wurden ausserhalb befestigt, da diese Sachen im Fall der Noth
schnell zu erreichen sein müssen. Längs des Wagendaches war eine
dünne Eisenstange angebracht, welche leicht von einer Seite zur anderen
übertragen werden konnte und zur Befestigung eines schräg zur Erde
verlaufenden Sonnenzeltes diente. Diese sehr hübsche Einrichtung habe
ich selbst wenig Veranlassung gehabt zu benutzen, da mir späterhin in
den Niederlassungen stets eine Hütte zu Gebote stand, in welcher ich
arbeiten konnte, und ich dies des grösseren Raumes, sowie der kühleren
Luft wegen vorzog. Hätte ich eine richtige Regenzeit bei dieser Unternehmung
durchgemacht, so wäre mir das Zelt gewiss sehr zu statten
gekommen, und ich würde in ähnlicher Lage nicht gern ohne ein
solches reisen.
Hinten auf den Wagen waren zwei Wasserfässer aufgebunden, sowie
ein kleineres für den beständigen Gebrauch seitlich angehängt; der
eiserne Kochtopf, Rost und Cafékessel wurden ebenfalls ausserhalb angebunden
oder auf der Trappe befestigt. Auf diesem Gestell, welches
eigentlich als Tritt dient, um von hinten in den Wagen zu steigen, war
auch noch Raum genug, um Brennholz aufzupacken, falls es nöthig war,
solches für eine Strecke mitzuführen. Was die allgemeine Form und
Bauart des Fuhrwerks anbetriift, so dürfte die Abbildung mehr und
deutlicher sprechen, als es die ausführlichste Beschreibung vermöchte.
In der Wahl der Provisionen richtet man sich natürlich nach seinem
Gesehmacke ein; das was Jeder mitzunehmen pflegt, ist Café, Thee,
Zucker, Mehl, Reis, Schiffszwieback, Speck und etwas Spirituosen;
ausserdem aber bekommt man leicht alle beliebigen Provisionen in
Blechbüchsen zubereitet, so dass man auch Luxus treiben kann. Die
Waaren sind verschieden, ganz nach dem Lande, welches man zu bereisen
gedenkt; im Bechuanengebiet waren zur Zeit Gewehre, Munition, hellblaue
und rosa Glasperlen, sowie lavendelblaue Glaskorallen, Messer,
Nähzeug, europäische Kleider und Taback die gangbarsten Artikel.
Dr. G. Fritsch, Drei Jahre in Süd-Afrika. 18