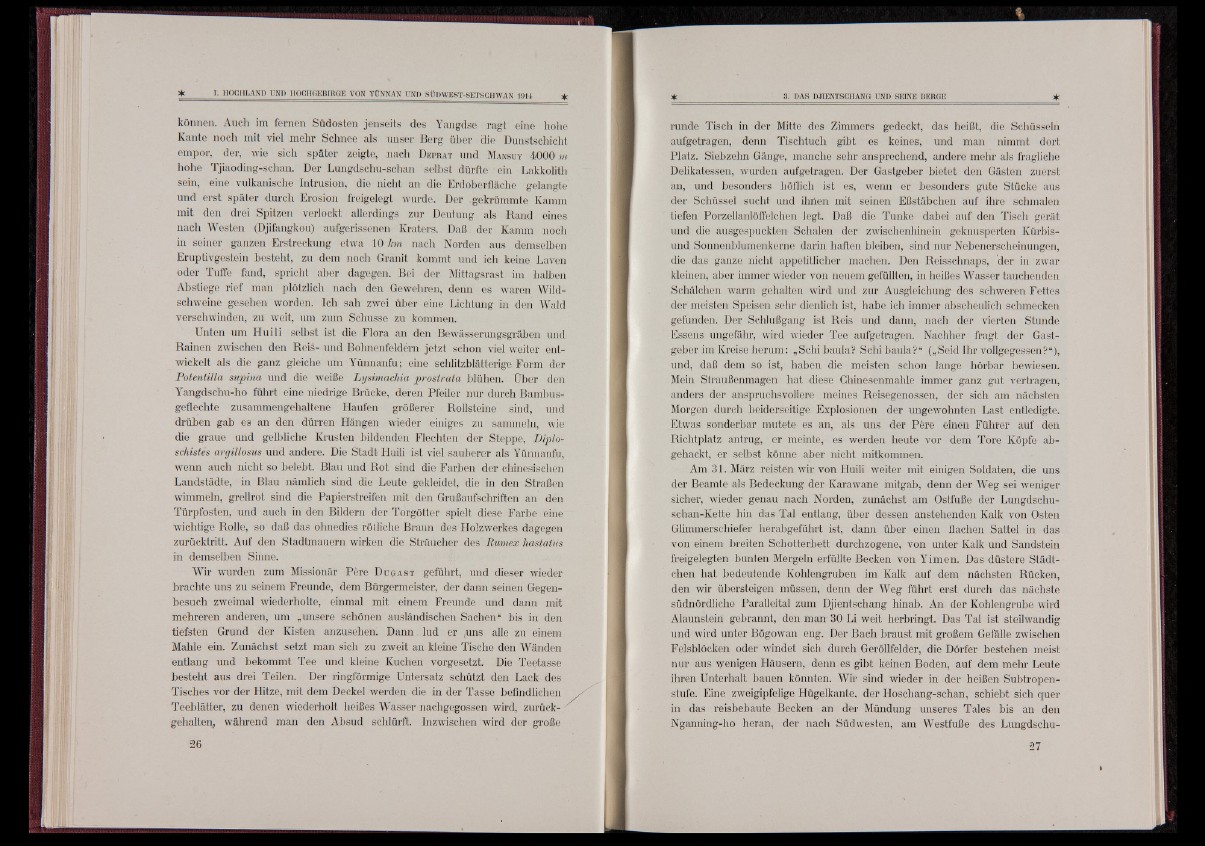
können. Auch im fernen Südosten jenseits des Yangdse ragt eine hohe
Kante noch mit viel mehr Schnee als unser Berg über die Dunstschicht
empor, der, wie sich später zeigte, nach D e pra t und M ansüy 4000 m
hohe Tjiaoding-schan. Der Lungdschu-schan selbst dürfte ein Lakkolith
sein, eine vulkanische Intrusion, die nicht an die Erdoberfläche gelangte
und erst später durch Erosion freigelegt wurde. Der gekrümmte Kamm
mit den drei Spitzen verlockt allerdings zur Deutung als Rand eines
nach Westen (Djifangkou) aufgerissenen Kraters. Daß der Kamm noch
in seiner ganzen Erstreckung etwa 10 km nach Norden aus demselben
Eruptivgestein besteht, zu dem noch Granit kommt und ich keine Laven
oder Tuffe fand, spricht aber dagegen. Bei der Mittagsrast im halben
Abstiege rief man plötzlich nach den Gewehren, denn es waren Wildschweine
gesehen worden. Ich sah zwei über eine Lichtung in den Wald
verschwinden, zu weit, um zum Schüsse zu kommen.
Unten um Huili selbst ist die Flora an den Bewässerungsgräben und
Rainen zwischen den Reis- und Bohnenfeldern jetzt schon viel weiter entwickelt
als die ganz gleiche um Yünnanfu; eine schlitzblätterige Form der
Potentilla supina und die weiße Lysimachia prostrata blühen. Über den
Yangdschu-ho führt eine niedrige Brücke, deren Pfeiler nur durch Bambusgeflechte
zusammengehaltene Haufen größerer Rollsteine sind, und
drüben gab es an den dürren Hängen wieder einiges zu sammeln, wie
die graue und gelbliche Krusten bildenden Flechten der Steppe, Diplo-
schistès argillosus und andere. Die Stadt- Huili ist viel sauberer als Yünnanfu,
wenn auch nicht so belebt. Blau und Rot sind die Farben der chinesischen
Landstädte, in Blau nämlich sind die Leute gekleidet, die in den Straßen
wimmeln, grellrot sind die Papierstreifen mit den Grußaufschriften an den
Türpfosten, und auch in den Bildern der Torgötter spielt diese Farbe eine
wichtige Rolle, so daß das ohnedies rötliche Braun des Holzwerkes dagegen
zurücktritt. Auf den Stadtmauern wirken die Sträucher des Rumex hastatüs
in demselben Sinne.
Wir wurden zum Missionär Père D u ç a s t geführt, und dieser wieder
brachte uns zu seinem Freunde, dem Bürgermeister, der dann seinen Gegenbesuch
zweimal wiederholte, einmal mit einem Freunde und dann mit
mehreren anderen, um „unsere schönen ausländischen Sachen“ bis in den
tiefsten Grund der Kisten anzusehen. Dann lud er ,uns alle zu einem
Mahle ein. Zunächst setzt man sich zu zweit an kleine Tische den Wänden
entlang und bekommt Tee und kleine Kuchen vorgesetzt. Die Teetasse
besteht aus drei Teilen. Der ringförmige Untersatz schützt den Lack des
Tisches vor der Hitze, mit dem Deckel werden die in der Tasse befindlichen
Teeblätter, zu denen wiederholt heißes Wasser nachgegossen wird, zurück- x
gehalten, während man den Absud schlürft. Inzwischen wird der große
runde Tisch in der Mitte des Zimmers gedeckt, das heißt, die Schüsseln
aufgetragen, denn Tischtuch gibt es keines, und man nimmt dort
Platz. Siebzehn Gänge, manche sehr ansprechend, andere mehr als fragliche
Delikatessen, wurden aufgetragen. Der Gastgeber bietet den Gästen zuerst
an, und besonders höflich ist es, wenn er besonders gute Stücke aus
der Schüssel sucht und ihnen mit seinen Eßstäbchen auf ihre schmalen
tiefen Porzellanlöffeichen legt. Daß die Tunke dabei auf den Tisch gerät
und die ausgespuckten Schalen der zwischenhinein geknusperten Kürbis-
und Sonnenblumenkerne darin haften bleiben, sind nur Nebenerscheinungen,
die das ganze nicht appetitlicher machen. Den Reisschnaps, der in zwar
kleinen, aber immer wieder von neuem gefüllten, in heißes Wasser tauchenden
Schälchen warm gehalten wird und zur Ausgleichung des schweren Fettes
der meisten Speisen sehr dienlich ist, habe ich immer abscheulich schmecken
gefunden. Der Schlußgang ist Reis un,d dann, nach der vierten Stunde
Essens ungefähr, wird wieder Tee aufgetragen. Nachher fragt der Gastgeber
im Kreise herum: „Schi baula? Schi baula?“ („Seid Ihr vollgegessen?“),
und, daß dem so ist, haben die meisten schon lange hörbar bewiesen.
Mein Straußenmagen hat diese Chinesenmahle immer ganz gut vertragen,
anders der anspruchsvollere meines Reisegenossen, der sich am nächsten
Morgen durch beiderseitige Explosionen der ungewohnten Last entledigte.
Etwas sonderbar mutete es an, als uns der Pere einen Führer auf den
Richtplatz antrug, er meinte, es werden heute vor dem Tore Köpfe abgehackt,
er selbst könne aber nicht mitkommen.
Am 31. März reisten wir von Huili weiter mit einigen Soldaten, die uns
der Beamte als Bedeckung der Karawane mitgab, denn der Weg sei weniger
sicher, wieder genau nach Norden, zunächst am Ostfuße der Lungdschu-
schan-Kette hin das Tal entlang, über dessen anstehenden Kalk von Osten
Glimmerschiefer herabgeführt ist, dann über einen flachen Sattel in das
von einem breiten Schotterbett durchzogene, von unter Kalk und Sandstein
freigelegten bunten Mergeln erfüllte Becken von Yimen. Das düstere Städtchen
hat bedeutende Kohlengruben im Kalk auf dem nächsten Rücken,
den wir übersteigen müssen, denn der Weg führt erst durch das nächste
südnördliche Paralleltal zum Djientschang hinab. An der Kohlengrube wird
Alaunstein gebrannt, den man 30 Li weit herbringt. Das Tal ist steilwandig
und wird unter Bögowan eng. Der Bach braust mit großem Gefälle zwischen
Felsblöcken oder windet sich durch Geröllfelder, die Dörfer bestehen meist
nur aus wenigen Häusern, denn es gibt keinen Boden, auf dem mehr Leute
ihren Unterhalt bauen könnten. Wir sind wieder in der heißen Subtropenstufe.
Eine zweigipfelige Hügelkante, der Hoschang-schan, schiebt sich quer
in das reisbebaute Becken an der Mündung unseres Tales bis an den
Nganning-ho heran, der nach Südwesten, am Westfuße des Lungdschu