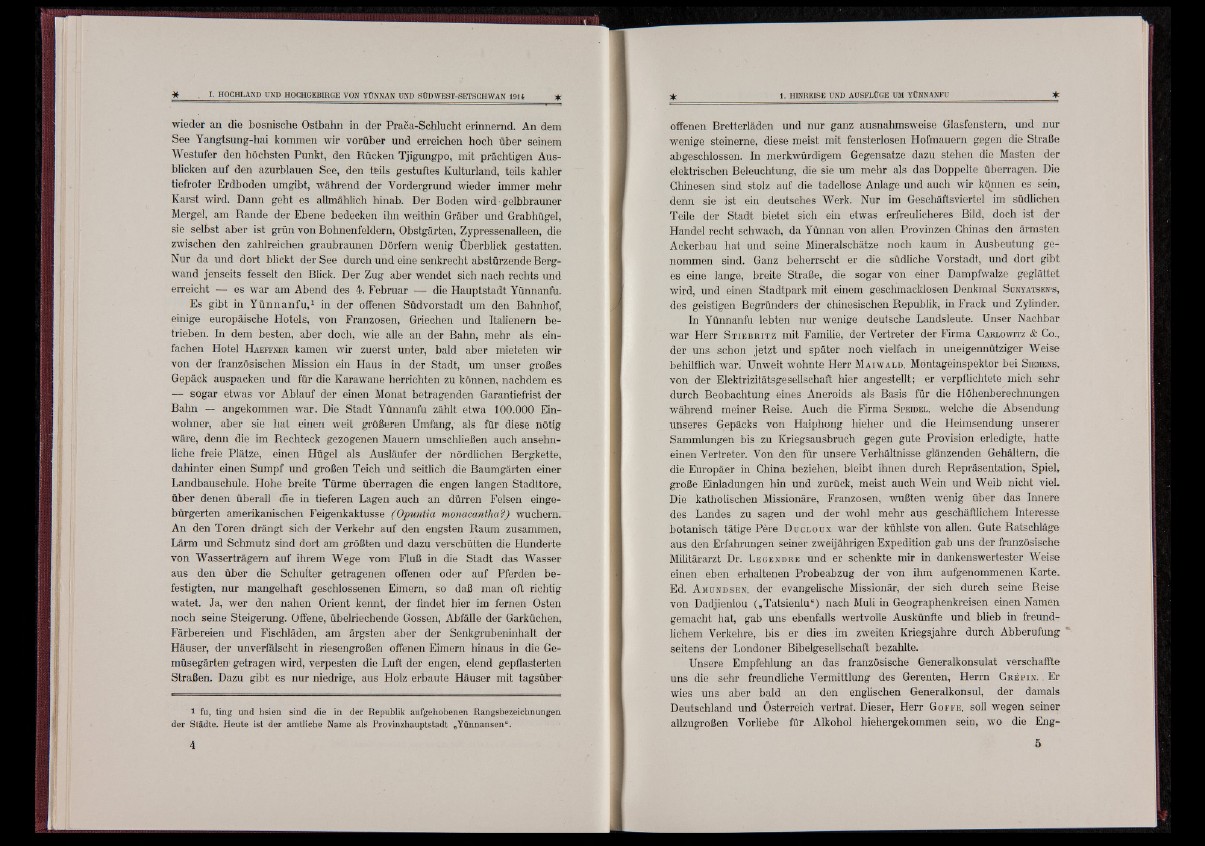
wieder an die bosnische Ostbahn in der Praca-Schlucht erinnernd. An dem
See Yangtsung-hai kommen wir vorüber und erreichen hoch über seinem
Westufer den höchsten Punkt, den Rücken Tjigungpo, mit prächtigen Ausblicken
auf den azurblauen See, den teils gestuftes Kulturland, teils kahler
tiefroter Erdboden umgibt, während der Vordergrund wieder immer mehr
Karst wird. Dann geht es allmählich hinab. Der Boden wird gelbbrauner
Mergel, am Rande der Ebene bedecken ihn weithin Gräber und Grabhügel,
sie selbst aber ist grün von Bohnenfeldern, Obstgärten, Zypressenalleen, die
zwischen den zahlreichen graubraunen Dörfern wenig Überblick gestatten.
Nur da und dort blickt der See durch und eine senkrecht abstürzende Bergwand
jenseits fesselt den Blick. Der Zug aber wendet sich nach rechts und
erreicht — es war am Abend des 4. Februar — die Hauptstadt Yünnanfu.
Es gibt in Y ü n n an fu ,1 in der offenen Südvorstadt um den Bahnhof,
einige europäische Hotels, von Franzosen, Griechen und Italienern betrieben.
In dem besten, aber doch, wie alle an der Bahn, mehr als einfachen
Hotel H aeffner kamen wir zuerst unter, bald aber mieteten wir
von der französischen Mission ein Haus in der Stadt, um unser großes
Gepäck auspacken und für die Karawane herrichten zu können, nachdem es
— sogar etwas vor Ablauf der einen Monat betragenden Garantiefrist der
Bahn — angekommen war. Die Stadt Yünnanfu zählt etwa 100.000 Einwohner,
aber sie hat einen weit größeren Umfang, als für diese nötig
wäre, denn die im Rechteck gezogenen Mauern umschließen auch ansehnliche
freie Plätze, einen Hügel als Ausläufer der nördlichen Bergkette,
dahinter einen Sumpf und großen Teich und seitlich die Baumgärten einer
Landbauschule. Hohe breite Türme überragen die engen langen Stadttore,,
über denen überall die in tieferen Lagen auch an dürren Felsen eingebürgerten
amerikanischen Feigenkaktusse (Opuntia monacantha?) wuchern.
An den Toren drängt sich der Verkehr auf den engsten Raum zusammen,
Lärm und Schmutz sind dort am größten und dazu verschütten die Hunderte
von Wasserträgern auf ihrem Wege vom Fluß in die Stadt das Wasser
aus den über die Schulter getragenen offenen oder auf Pferden befestigten,
nur mangelhaft geschlossenen Eimern, so daß man oft richtig
watet. Ja, wer den nahen Orient kennt, der findet hier im fernen Osten
noch seine Steigerung. Offene, übelriechende Gossen, Abfälle der Garküchen,
Färbereien und Fischläden, am ärgsten aber der Senkgrubeninhalt der
Häuser, der unverfälscht in riesengroßen offenen Eimern hinaus in die Gemüsegärten
getragen wird, verpesten die Luft der engen, elend gepflasterten
Straßen. Dazu gibt es nur niedrige, aus Holz erbaute Häuser mit tagsüber
1 fu, ting und hsien sind die in der Republik aufgehobenen Rangsbezeichnungen
der Slädte. Heute ist der amtliche Name als Prorinzhauptstadt „Yünnansen“.
offenen Bretterläden und nur ganz ausnahmsweise Glasfenstern, und nur
wenige steinerne, diese meist mit fensterlosen Hofmauern gegen die Straße
abgeschlossen. In merkwürdigem Gegensätze dazu stehen die Masten der
elektrischen Beleuchtung, die sie um mehr als das Doppelte überragen. Die
Chinesen sind stolz auf die tadellose Anlage und auch wir können es sein,
denn sie ist ein deutsches Werk. Nur im Geschäftsviertel im südlichen
Teile der Stadt bietet sich ein etwas erfreulicheres Bild, doch ist der
Handel recht schwach, da Yünnan von allen Provinzen Chinas den ärmsten
Ackerbau hat und seine Mineralschätze noch kaum in Ausbeutung genommen
sind. Ganz beherrscht er die südliche Vorstadt, und dort gibt
es eine lange, breite Straße, die sogar von einer Dampfwalze geglättet
wird, und einen Stadtpark mit einem geschmacklosen Denkmal S unyatsen>s ,
des geistigen Begründers der chinesischen Republik, in Frack und Zylinder.
In Yünnanfu lebten nur wenige deutsche Landsleute. Unser Nachbar
war Herr S t i e b r i t z mit Familie, der Vertreter der Firma C arlowitz & Co.,
der uns schon jetzt und später noch vielfach in uneigennütziger Weise
behilflich war. Unweit wohnte Herr M a iw a l d , Möntageinspektor bei S iemens,
von der Elektrizitätsgesellschaft hier angestellt; er verpflichtete mich sehr
durch Beobachtung eines Aneroids als Basis für die Höhenberechnungen
während meiner Reise. Auch die Firma S p eid e l , -welche die Absendung
unseres Gepäcks von Haiphong hieher und die Heimsendung unserer
Sammlungen bis zu Kriegsausbruch gegen gute Provision erledigte, hatte
einen Vertreter. Von den für unsere Verhältnisse glänzenden Gehältern, die
die Europäer in China beziehen, bleibt ihnen durch Repräsentation, Spiel,
große Einladungen hin und zurück, meist auch Wein und Weib nicht viel.
Die katholischen Missionäre, Franzosen, wußten wenig über das Innere
des Landes zu sagen und der wohl mehr aus geschäftlichem Interesse
botanisch tätige Père D u c l o u x war der kühlste von allen. Gute Ratschläge
aus den Erfahrungen seiner zweijährigen Expedition gab uns der französische
M ilit ä r a r z t . Dr. L e g e n d r e und er schenkte mir in dankenswertester Weise
einen eben erhaltenen Probeabzug der von ihm aufgenommenen Karte.
Ed. A m u n d s e n , der evangelische Missionär, der sich durch seine Reise
von Dadjienlou („Tatsienlu“) nach Muli in Geographenkreisen einen Namen
gemacht hat, gab uns ebenfalls wertvolle Auskünfte und blieb in freundlichem
Verkehre, bis er dies im zweiten Kriegsjahre durch Abberufung
seitens der Londoner Bibelgesellschaft bezahlte.
Unsere Empfehlung an das französische Generalkonsulat verschaffte
uns die sehr freundliche Vermittlung des Gerenten, Herrn C r é p in . . Er
wies uns aber bald an den englischen Generalkonsul, der damals
Deutschland und Österreich vertrat. Dieser, Herr G o f f e , soll wegen seiner
allzugroßen Vorliebe für Alkohol hiehergekommen sein, wo die Eng