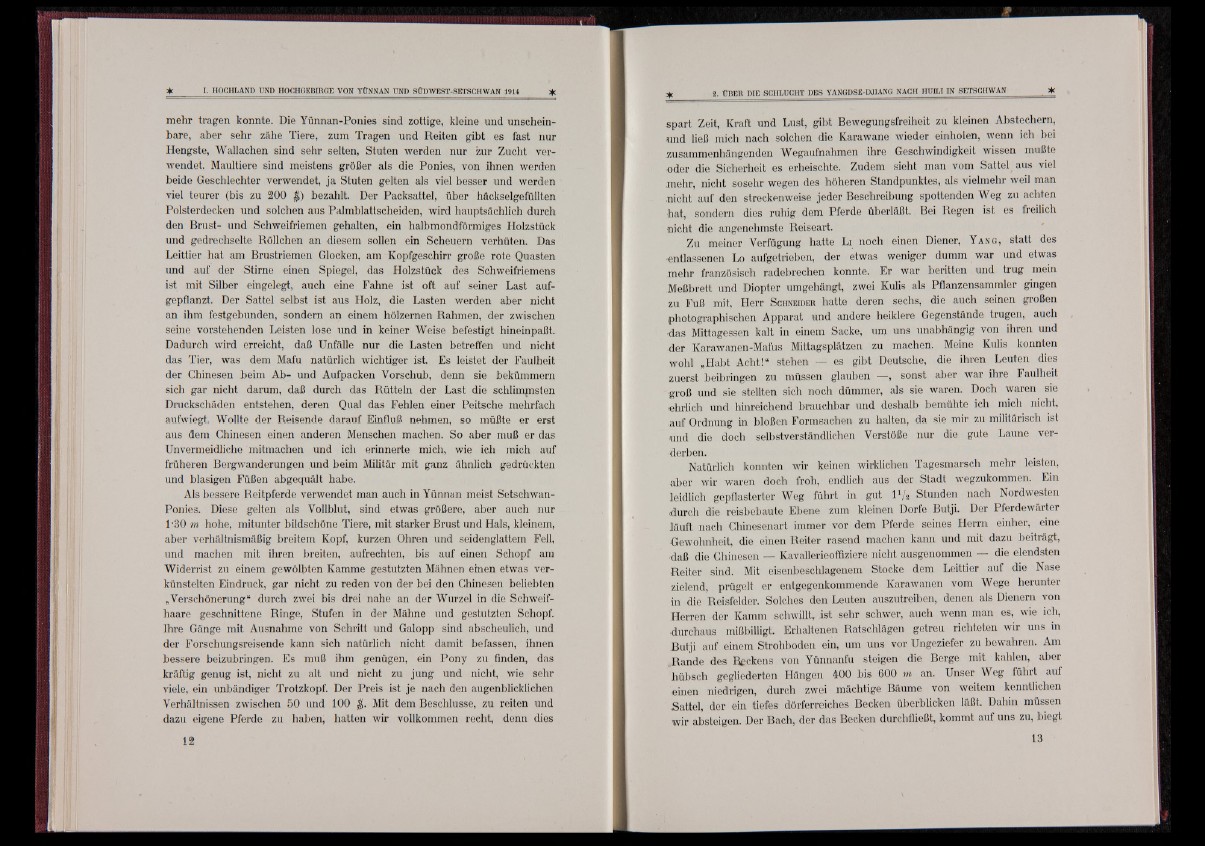
mehr tragen konnte. Die Yünnan-Ponies sind zottige, kleine und unscheinbare,
aber sehr zähe Tiere, zum Tragen und Reiten gibt es fast hur
Hengste, Wallachen sind sehr selten, Stuten werden nur zur Zucht verwendet.
Maultiere sind meistens größer als die Ponies, von ihnen werden
beide Geschlechter verwendet, ja Stuten gelten als viel besser und werden
viel teurer (bis zu 200 $) bezahlt. Der Packsattel, über häckselgefüllten
Polsterdecken und solchen aus Palmblattscheiden, wird hauptsächlich durch
den Brust- und Schweifriemen gehalten, ein halbmondförmiges Holzstück
und gedrechselte Röllchen an diesem sollen ein Scheuern verhüten. Das
Leittier hat am Brustriemen Glocken, am Kopfgeschirr große rote Quasten
und auf der Stirne einen Spiegel, das Holzstück des Schweifriemens
ist mit Silber eingelegt, auch eine Fahne ist oft auf seiner Last aufgepflanzt.
Der Sattel selbst ist aus Holz, die Lasten werden aber nicht
an ihm festgebunden, sondern an einem hölzernen Rahmen, der zwischen
seine vorstehenden Leisten lose und in keiner Weise befestigt hineinpaßt.
Dadurch wird erreicht, daß Unfälle nur die Lasten betreffen und nicht
das Tier, was dem Mafu natürlich wichtiger ist. Es leistet der Faulheit
der Chinesen beim Ab- und Aufpacken Vorschub, denn sie bekümmern
sich gar nicht darum, daß durch das Rütteln der Last die schlimjnsten
Druckschäden entstehen, deren Qual das Fehlen einer Peitsche mehrfach
aufwiegt. Wollte der Reisende darauf Einfluß nehmen, so müßte er erst
aus dem Chinesen einen anderen Menschen machen. So aber muß er das
Unvermeidliche mitmachen und ich erinnerte mich, wie ich mich auf
früheren Bergwanderungen und beim Militär mit ganz ähnlich gedrückten
und blasigen Füßen abgequält habe.
Als bessere Reitpferde verwendet man auch in Yünnan meist Setschwan-
Ponies. Diese gelten als Vollblut, sind etwas größere, aber auch nur
l -30 m hohe, mitunter bildschöne Tiere, mit starker Brust und Hals, kleinem,
aber verhältnismäßig breitem Kopf, kurzen Ohren und seidenglattem Fell,
und machen mit ihren breiten, aufrechten, bis auf einen Schopf am
Widerrist zu einem gewölbten Kamme gestutzten Mähnen einen etwas ver-
künstelten Eindruck, gar nicht zu reden von der bei den Chinesen beliebten
»Verschönerung“ durch zwei bis drei nahe an der Wurzel in die Schweifhaare
geschnittene Ringe, Stufen in der Mähne und gestutzten Schopf.
Ihre Gänge mit Ausnahme von Schritt und Galopp sind abscheulich, und
der Forschungsreisende kann sich natürlich nicht damit befassen, ihnen
bessere beizubringen. Es muß ihm genügen, ein Pony zu finden, das
kräftig genug ist, nicht zu alt und nicht zu jung und nicht, wie sehr
viele, ein unbändiger Trotzkopf. Der Preis ist je nach den augenblicklichen
Verhältnissen zwischen 50 und 100 $. Mit dem Beschlüsse, zu reiten und
dazu eigene Pferde zu haben, hatten wir vollkommen recht, denn dies
spart Zeit, Kraft und Lust, gibt Bewegungsfreiheit zu kleinen Abstechern,
und ließ mich nach solchen die Karawane wieder einholen, wenn ich bei
zusammenhängenden Wegaufnahmen ihre Geschwindigkeit wissen mußte
oder die Sicherheit es erheischte. Zudem sieht man vom Sattel aus viel
mehr, nicht sosehr wegen des höheren Standpunktes, als vielmehr weil man
■nicht auf den streckenweise jeder Beschreibung spottenden Weg zu achten
hat, sondern dies ruhig dem Pferde überläßt. Bei Regen ist es freilich
•nicht die angenehmste Reiseart.
Zu meiner Verfügung hatte Li noch einen Diener, Yang, statt des
-entlassenen Lo aufgetrieben, der etwas weniger dumm war und etwas
mehr französisch radebrechen konnte. Er war beritten und trug mein
Meßbrett und Diopter umgehängt, zwei Kulis als Pflanzensammler gingen
zu Fuß mit, Herr S chneider hatte deren sechs, die auch seinen großen
photographischen Apparat und andere heiklere Gegenstände trugen, auch
-das Mittagessen kalt in einem Sacke, um uns unabhängig von ihren und
der Karawanen-Mafus Mittagsplätzen zu machen. Meine Kulis konnten
wohl „Habt Acht!“ stehen — es gibt Deutsche, die ihren Leuten dies
zuerst beibringen zu müssen glauben —, sonst aber war ihre Faulheit
groß und sie stellten sich noch dümmer, als sie waren. Doch waren sie
ehrlich und hinreichend brauchbar und deshalb bemühte ich mich nicht,
auf Ordnung in bloßen Formsachen zu halten, da sie mir zu militärisch ist
und die doch selbstverständlichen Verstöße nur die gute Laune verderben.
Natürlich konnten wir keinen wirklichen Tagesmarsch mehr leisten,
aber wir waren doch froh, endlich aus der Stadt wegzukommen. Ein
leidlich gepflasterter Weg führt in gut D/a Stunden nach Nordwesten
durch die reisbebaute Ebene zum kleinen Dorfe Butji. Der Pferdewärter
läuft nach Chinesenart immer vor dem Pferde seines Herrn einher, eine
Gewohnheit, die einen Reiter rasend machen kann und mit dazu beiträgt,
■daß die Chinesen — Kavallerieoffiziere nicht ausgenommen — die elendsten
Reiter sind. Mit eisenbeschlagenem Stocke dem Leittier auf die Nase
zielend, prügelt er entgegenkommende Karawanen vom Wege herunter
in die Reisfelder. Solches den Leuten auszutreiben, denen als Dienern von
Herren der Kamm schwillt, ist sehr schwer, auch wenn man es, wie ich,
durchaus mißbilligt. Erhaltenen Ratschlägen getreu richteten wir uns in
Butji auf einem Strohboden ein, um uns vor Ungeziefer zu bewahren. Am
Rande des Beckens von Yünnanfu steigen die Berge mit kahlen, aber
hübsch gegliederten Hängen 400 bis 600 m an. Unser Weg führt auf
einen niedrigen, durch zwei mächtige Bäume von weitem kenntlichen
Sattel, der ein tiefes dörferreiches Becken überblicken läßt. Dahin müssen
wir absteigen. Der Bach, der das Becken durchfließt, kommt auf uns zu, biegt