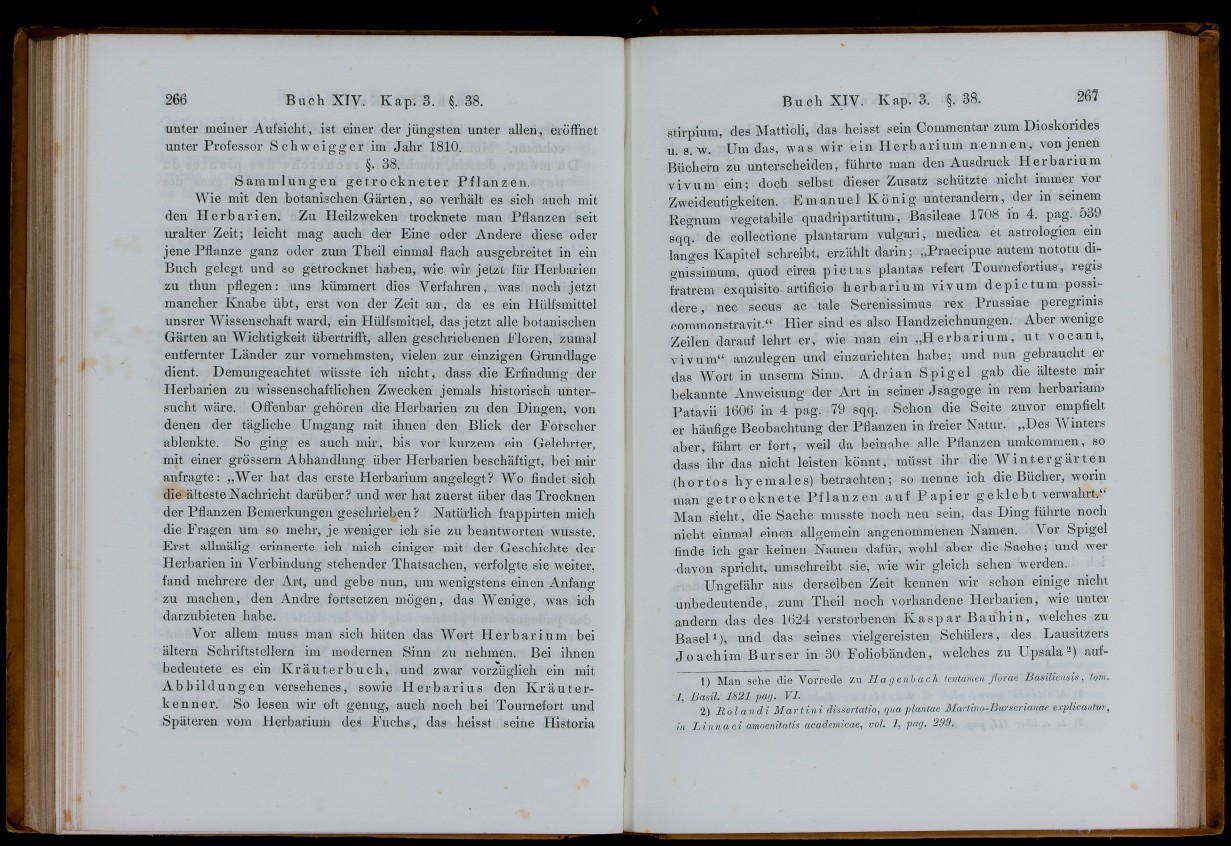
\
266 B u c h XIV. Kap. 3. §. 38.
unter meiner Aufsicht, ist einer der jüngsten unter allen, eröffnet
unter Professor Schweigger im Jahr 1810.
§. 38.
S a m m l u n g e n getrockneter Pflanzen,
Wie mit den botanischen Gärten, so verhält es sich auch mit
den Herbarien. Zu Heilzweken trocknete man Pflanzen seit
uralter Zeit; leicht mag auch der Eine oder Andere diese oder
jene Pflanze ganz oder zum Theil einmal flach ausgebreitet in ein
Buch gelegt und so getrocknet haben, wie wir jetzt für Herbarien
zu thun pflegen: uns kümmert dies Verfahren, was noch jetzt
mancher Knabe übt, erst von der Zeit an, da es ein Hülfsmittel
unsrer Wissenschaft ward, ein Hülfsmit:^el, das jetzt alle botanischen
Gärten an Wichtigkeit übertrifll, allen geschriebenen Floren, zumal
entfernter Länder zur vornehmsten, vielen zur einzigen Grundlage
dient. Demungeachtet wüsste ich nicht, dass die Erfindung der
Herbarien zu wissenschaftlichen Zwecken jemals historisch untersucht
wäre. Offenbar gehören die Herbarien zu den Dingen, von
denen der täghche Umgang mit ihnen den Blick der Forscher
ablenkte. So ging es auch mir, bis vor kurzem ein Gelehrter,
mit einer grössern Abhandlung über Herbarien beschäftigt, bei mir
anfragte: „Wer hat das erste Herbarium angelegt? Wo findet sich
die älteste Nachricht darüber? und wer hat zuerst über das Trocknen
der Pflanzen Bemerkungen geschrieben? Natürlich frappirten mich
die Fragen um so mehr, j e weniger ich sie zu beantworten wusste.
Erst allmälig erinnerte ich mich einiger mit der Geschichte der
Herbarien in Verbindung stehender Thatsachen, verfolgte sie weiter,
fand mehrere der Art, und gebe nun, um wenigstens einen Anfang
zu machen, den Andre fortsetzen mögen, das Wenige, was ich
darzubieten habe.
Vor allem muss man sich hüten das Wort Herbarium bei
ältern Schriftstellern im modernen Sinn zu nehmen. Bei ihnen
bedeutete es ein Kräuter buch, und zwar vorz'üghch ein mit
A b b i l d u n g e n versehenes, sowie Herbarius den Kräuterkenner.
So lesen wir oft genug, auch noch bei Tournefort und
Späteren vom Herbarium des Fuchs, das heisst seine Historia
B u c h XIV. Kap. 3. §.38. 267
stirpium, des Mattioli, das heisst sein Commentar zum Dioskorides
U.S.W. Um das, was wir ein Herbarium nennen, von jenen
Büchern zu unterscheiden, führte man den Ausdruck Herbarium
vivum ein; doch selbst dieser Zusatz schützte nicht immer vor
Zweideutigkeiten. E m an u e 1 K ö n i g unterandern, der in seinem
Regnum vegetabile quadripartitum, Basileae 1708 in 4. pag. 539
sqq. de collectione plantarum vulgari, medica et astrologica ein
langes Kapitel schreibt, erzählt darin; „Praecipue autem nototu dignissimum,
quod circa pictas plantas refert Tournefortius, regis
fratrem exquisito artificio herbarium vivum depictum possi=
dere, nee secus ac tale Serenissimus rex Prussiae peregrinis
commonstravit." Hier sind es also Handzeichnungen. Aber wenige
Zeilen darauf lehrt er, wie man ein „Herbarium, ut vocant,
vivum" anzulegen und einzurichten habe; und nun gebraucht er
das Wort in unserm Sinn. Adrian Spigel gab die älteste mir
bekannte Anweisung der Art in seiner Jsagoge in rem herbariam.
Patavii 1606 in 4 pag. 79 sqq. Schon die Seite zuvor empfielt
er häufige Beobachtung der Pflanzen in freier Natur. „Des Winters
aber, fährt er fort, weil da beinahe alle Pflanzen umkommen, so
dass ihr das nicht leisten könnt, müsst ihr die Wintergärten
(hörtos hyemales) betrachten; so nenne ich die Bücher, worin
man getrocknet e Pflanzen auf Papier geklebt verwahrt."
Man sieht, die Sache musste noch neu sein, das Ding führte noch
nicht einmal einen allgemein angenommenen Namen. Vor Spigel
finde ich gar keinen Namen dafür, wohl aber die Sache; und wer
davon spricht, umschreibt sie, wie wir gleich sehen werden.
Ungefähr aus derselben Zeit kennen wir schon einige nicht
unbedeutende, zum Theil noch vorhandene Herbarien, wie unter
andern das des 1624 verstorbenen Kaspar Bau h in, welches zu
Basel 1), und das seines vielgereisten Schülers, des Lausitzers
J o a c h im Burser in 30 Foliobänden, welches zu Upsala 2) auft
) Man sehe die Vorrede zu Hagenhach ientamen florae Basiiiends, lom,
i, Basil. 1821 pag. VI.
2) Rolandi Martini dissertatio, qua plantae Martino-Burserianae expUcantur,
in Linnaei amoenitatis academicae, vol. ./, pag, 299.
h
«tr