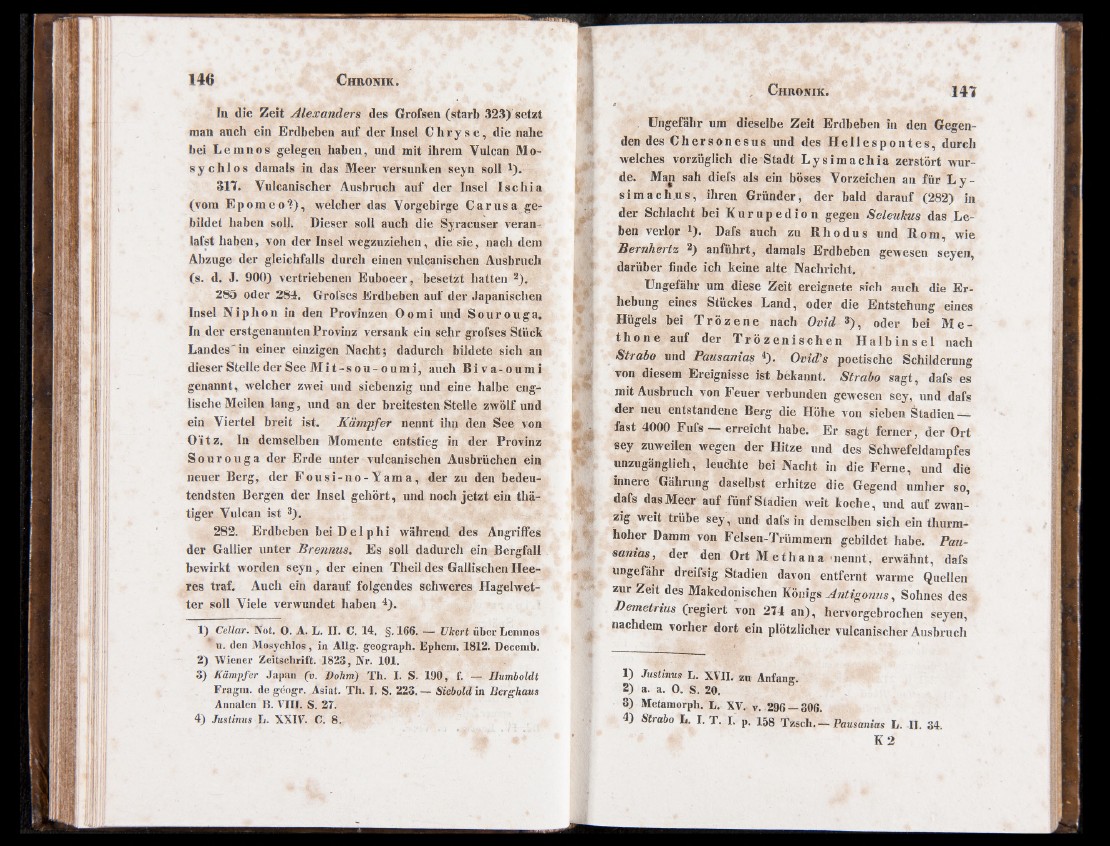
In die Zeit Alexanders des Grofsen (starb 323) setzt
man auch ein Erdbeben auf der Insel C h ry se , die nahe
bei Lem nos gelegen haben, und mit ihrem Vulcan Mo-
sy ch lo s damals in das Meer versunken seyn soll t).
317. Vulcanischer Ausbruch auf der Insel Ischia
(vom E pom eo“?), welcher das Vorgebirge C arusa ge*
bildet haben soll. Dieser soll auch die Syracuser veran-
lafst haben, von der Insel wegzuziehen, die sie, nach dem
Abzüge der gleichfalls durch einen vuicanischen Ausbruch
(s. d. J. 900) vertriebenen Euboeer, besetzt hatten 1 2).
285 oder 284. Grofses Erdbeben auf der Japanischen
Insel N iphon in den Provinzen Oomi und Sourouga.
In der erstgenannten Provinz versank ein sehr grofses Stück
Landes”in einer einzigen Nacht; dadurch bildete sich an
dieser Stelle der See M it-s ou- oum i, auch B iva-oum i
genannt, welcher zwei und siebenzig und eine halbe englische
Meilen lang, und an der breitesten Stelle zwölf und
ein Viertel breit ist. Kämpfer nennt ihn den See von
O'itz. In demselben Momente entstieg in der Provinz
S ourouga der Erde unter vuicanischen Ausbrüchen ein
neuer Berg, der F o u si-n o -Y am a, der zu den bedeutendsten
Bergen der Insel gehört, und noch jetzt ein thä-
tiger Vulcan ist 3).
282. Erdbeben bei D elp h i während des Angriffes
der Gallier unter Brennus. Es soll dadurch ein Bergfall
bewirkt worden seyn, der einen Theil des Gallischen Heeres
traf. Auch ein darauf folgendes schweres Hagelwetter
soll Viele verwundet haben 4).
1) Cellar. Not. 0. A. L. II. C. 14. §. 166. — U kert über Lemnos
u. den Mosychlos, in Alig. geograph. Ephem. 1812. Decemb.
2) Wiener Zeitschrift. 1823, Nr. 101.
3) Kämpfer Japan (v. Dohm) Th. I. S. 190, f. — Humboldt
Fragm. de geogr. Asiat. Th. I. S. 223.— Siebold in Berghaus
Annalen B. VIII. S. 27.
4) Justinus L. XXIV. C. 8.
C h ro n ik . 147
. Ungefähr um dieselbe Zeit Erdbeben in den Gegenden
des C h erso n esu s und des H e lle sp o n te s, durch
welches vorzüglich die Stadt L ysim achia zerstört wurde.
Man sah diefs als ein böses Vorzeichen an für L y-
sim ach u s, ihren Gründer, der bald darauf (282) in
der Schlacht bei K u ru p ed io n gegen SeleuTcus das Leben
verlor *). Dafs auch zu R h o d u s und Rom, wie
Bernhertz 2) anführt, damals Erdbeben gewesen seyen,
darüber finde ich keine alte Nachricht.
Ungefähr um diese Zeit ereignete sich auch die Erhebung
eines Stückes Land, oder die Entstehung eines
Hügels bei T rö z e n e nach Ovid 3>, oder bei M e-
th o n e auf der T rö z e n is c h e n H a lb in s e l nach
Strabo und Pausanias 4). Ovid’s poetische Schilderung
von diesem Ereignisse ist bekannt. Strabo sagt, dafs es
mit Ausbruch von Feuer verbunden gewesen sey, und dafs
der neu entstandene Berg die Höhe von sieben Stadien —
fast 4000 Fufs — erreicht habe. Er sagt ferner, der Ort
sey zuweilen wegen der Hitze und des Schwefeldampfes
unzugänglich, leuchte bei Nacht in die Ferne, und die
innere Gährung daselbst erhitze die Gegend umher so,
dafs das Meer auf fünf Stadien weit koche, und auf zwanzig
weit trübe sey,und dafs in demselben sich ein thurmhoher
Damm von Felsen-Trümmern gebildet habe. Pausanias,
der den Ort M e th a n a -nennt, erwähnt, dafs
ungefähr dreifsig Stadien davon entfernt warme Quellen
zur Zeit des Makedonischen Königs Antigonus, Sohnes des
Demetrius (regiert von 274 an), hervorgebrochen seyen,
nachdem vorher dort ein plötzlicher vulcanischer Ausbruch
1) Justinus L. XVII, zu Anfang*.
2) a. a. 0. S. 20.
3) Metamorph. L. XV. v. 296 — 306.
4) Strabo L. I. T. I. p. 158 Tzsch. — Pausanias L. II. 34,
K 2