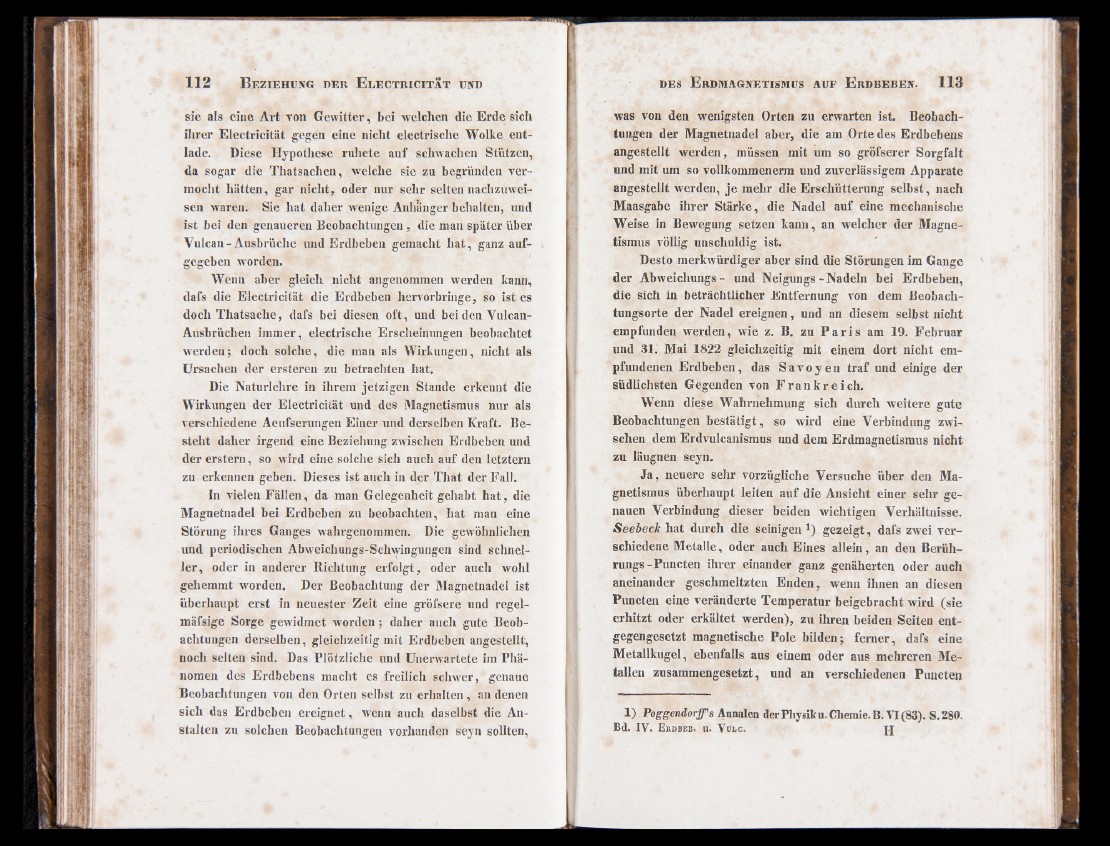
sie als eine Art von Gewitter, bei welchen die Erde sich
ihrer Electricität gegen eine nicht electrisclie Wolke entlade.
Diese Hypothese ruhete auf schwachen Stützen,
da sogar die Thatsachen, welche sie zu begründen vermocht
hätten, gar nicht, oder nur sehr selten nachzuweisen
waren. Sie hat daher wenige Anhänger behalten, und
ist bei den genaueren Beobachtungen , die man später über
Vulcan - Ausbrüche und Erdbeben gemacht hat, ganz aufgegeben
worden.
Wenn aber gleich nicht angenommen werden kann,
dafs die Electricität die Erdbeben hervorbringe, so ist es
doch Thatsaclie, dafs bei diesen oft, und bei den Vulcan-
Ausbrüchen immer, electrische Erscheinungen beobachtet
werden; doch solche, die man als Wirkungen, nicht als
Ursachen der ersteren zu betrachten hat.
Die Naturlehre in ihrem jetzigen Stande erkennt die
Wirkungen der Electricität und des Magnetismus nur als
verschiedene Aeufserungen Einer und derselben Kraft. Besteht
daher irgend eine Beziehung zwischen Erdbeben und
der erstem, so wird eine solche sich auch auf den letztem
zu erkennen geben. Dieses ist auch in der That der Fall.
In vielen Fällen, da man Gelegenheit gehabt hat, die
Magnetnadel bei Erdbeben zu beobachten, hat man eine
Störung ihres Ganges wahrgenommen. Die gewöhnlichen
und periodischen Abweichungs-Schwingungen sind schneller,
oder in anderer Richtung erfolgt, oder auch wohl
gehemmt worden. Der Beobachtung der Magnetnadel ist
überhaupt erst in neuester Zeit eine gröfsere und regel-
mäfsige Sorge gewidmet worden; daher auch gute Beobachtungen
derselben, gleichzeitig mit Erdbeben angestellt,
noch selten sind. Das Plötzliche und Unerwartete im Phänomen
des Erdbebens macht es freilich schwer, genaue
Beobachtungen von den Orten selbst zu erhalten, an denen
sich das Erdbeben ereignet, wenn auch daselbst die Anstalten
zu solchen Beobachtungen vorhanden seyn sollten,
was von den wenigsten Orten zu erwarten ist. Beobachtungen
der Magnetnadel aber, die am Orte des Erdbebens
angestellt werden, müssen mit um so gröfserer Sorgfalt
und mit um so vollkommenerm und zuverlässigem Apparate
angestellt werden, je mehr die Erschütterung selbst, nach
Maasgabe ihrer Stärke, die Nadel auf eine mechanische
Weise in Bewegung setzen kann, an welcher der Magnetismus
völlig unschuldig ist.
Desto merkwürdiger aber sind die Störungen im Gange
der Abweichungs - und Neigungs-Nadeln bei Erdbeben,
die sich in beträchtlicher Entfernung von dem Beobachtungsorte
der Nadel ereignen, und an diesem selbst nicht
empfunden werden, wie z. B. zu P a ris am 19. Februar
und 31. Mai 1822 gleichzeitig mit einem dort nicht empfundenen
Erdbeben, das Savoyen traf und einige der
südlichsten Gegenden von F ran k reich .
Wenn diese Wahrnehmung sich durch weitere gute
Beobachtungen bestätigt, so wird eine Verbindung zwischen
dem Erdvulcanismus und dem Erdmagnetismus nicht
zu läugnen seyn.
Ja, neuere sehr vorzügliche Versuche über den Magnetismus
überhaupt leiten auf die Ansicht einer sehr genauen
Verbindung dieser beiden wichtigen Verhältnisse.
Seebeclc hat durch die seinigen 1) gezeigt, dafs zwei verschiedene
Metalle, oder auch Eines allein, an den Berüh-
rungs-Puncten ihrer einander ganz genäherten oder auch
aneinander geschmeltzten Enden, wenn ihnen an diesen
Puncten eine veränderte Temperatur beigebracht wird (sie
erhitzt oder erkältet werden), zu ihren beiden Seiten entgegengesetzt
magnetische Pole bilden; ferner, dafs eine
Metallkugel, ebenfalls aus einem oder aus mehreren Metallen
zusammengesetzt, und an verschiedenen Puncten 1
1) Poggendorff's Annalen der Physik u. Chemie. B. VI (83). S. 280.
Bd. IV. Ekdbeb. u. Vulc. J-J