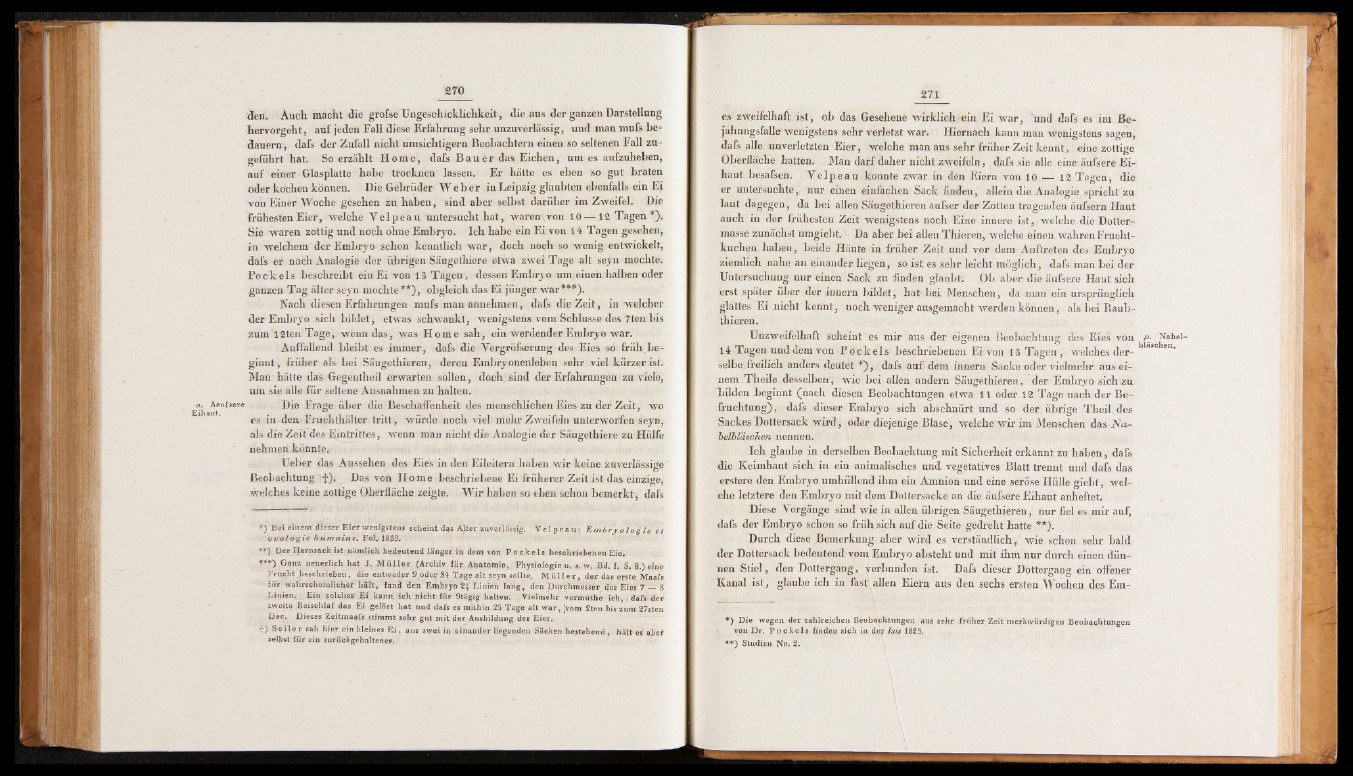
p. Aenfsere
E ih a u t,
den. Auch macht die grofse Ungeschicklichkeit, die aus der ganzen Darstellung
hervorgeht, auf jeden Fall diese Erfahrung sehr unzuverlässig, und man mufs Le»
dauern, dafs der Zufall nicht umsichtigem Beobachtern einen so seltenen Fall zugeführt
hat. So erzählt Home, dafs B a u e r das. Eichen, um es aufzuheben,
auf einer Glasplatte habe trocknen lassen. Er hätte es eben so gut braten
oder kochen können. Die Gebrüder W e b e r in Leipzig glaubten ebenfalls ein Ei
von Einer Woche gesehen zu haben, sind aber selbst darüber im Zweifel. Die
frühesten Eier, welche Y e lp e a u untersucht hat, warenwon 10 — 12 Tagen*).
Sie waren zottig und noch ohne Embryo. Ich habe ein Ei von 14 Tagen gesehen,
in welchem der Embryo schon kenntlich war, doch noch so wenig entwickelt,
dafs er nach Analogie der übrigen Säugethiere etwa zwei Tage alt seyn mochte.
Po ck e ls beschreibt ein Ei von 13 Tagen, dessen Embryo um einen halben oder
ganzen Tag^älter seyn mochte**), obgleich das Ei jünger war***).
Nach diesen Erfahrungen mufs man annehmen, dafs die Zeit, in welcher
der Embryo sich bildet, etwas schwankt, wenigstens vom Schlüsse des 7ten bis
zum 12ten Tage, wenn das, was Home sah, ein werdender Embryo war.
Auffallend bleibt es immer, dafs die Vergröfserung des Eies so friihbe-
ginut, früher als bei Säugethieren, deren Embryonenleben sehr viel kürzer ist.
Man hätte das Gegentheil erwarten sollen, doch sind der Erfahrungen zu viele,
um sie alle für seltene Ausnahmen zu halten.
Die Frage über die Beschaffenheit des menschlichen Eies zu der Zeit, wo
es in den Fruelithälter tritt , würde noch viel mehr Zweifeln unterworfen seyn,
als die Zeit des Eintrittes, wenn man nicht die Analogie der Säugethiere zu Hülfe
nehmen könnte«
Ueber das Aussehen des Eies in den Eileitern haben wir keine zuverlässige
Beobachtung f). Das von Home beschriebene Ei früherer Zeit ist das einzige,
welches keine zottige Oberfläche zeigte. Wir haben so eben schon bemerkt, dafs
*) Bei einem dieier Eier wenigstens scheint d^s Alter zuverlässig. V e lp e a u : E m b r y o lo g i e e t
ö v o lo g i e h um a in e . F<j1v 1833'.
**) Der Harnsack ist nämlich bedeutend länger in dem von P o c k e ls beschriebenen Eie.
♦**) Ganz neuerlich hat J. M ü lle r (Archiv für Anatomie, Physiologien, s. w. Bd. I. S. 8.) eine
Frucht beschrieben, die entweder 9 oder 34 Tage alt seyn sollte. M ü lle r , der das erste Maafs
für wahrscheinlicher halt, fand den Embryo 2§ Linien lang, den Durchmesser des Eies 7 — 8
m m 5olc^es Ei kann ich nicht für 9tägig' halten. Vielmehr vermuthe ich, • dafs der
zweite Beischlaf das Ei gelöst hat und dafs es mithin 25 Tage alt war, [vom 2ten bis zum 27sten
Dec. Dieses Zeitmaafs stimmt sehr gut mit der Ausbildung der Eier.
f ) S e ile r sah hier ein kleines E i, aus zwei in einander liegenden Säcken bestehend, hält es abetf
selbst fjjr ein zurückgehaltene«.
271
es zweifelhaft ist, ob das Gesehene wirklich-eiu Ei war, 'und dafs es im Bejahungsfälle
wenigstens sehr verletzt war. Hiernach kann man wenigstens sagen,
dafs alle unverletzten Eier, welche man aus sehr früher Zeit kennt, eine zottige
Oberfläche hatten. Man darf daher nicht zweifeln, dafs sie alle eine äufsere Eihaut
besafsen. Y e lp e a u konnte zwar in den Eiern von 10 — 12 Tagen, die
er untersuchte, nur einen einfachen Sack finden, allein die Analogie spricht zu
laut dagegen, da bei allen Säugethieren aufser der Zotten tragenden äufsern Haut
auch in der frühesten Zeit wenigstens noch Eine innere ist, welche die Dottermasse
zunächst umgiebt. Da aber bei allen Thieren, welche einen wahren Fruchtkuchen
haben, beide Häute in früher Zeit und vor dem Auftreten des Embryo
ziemlich nahe an einander liegen, so ist es sehr leicht möglich, dafs man bei der
Untersuchung nur einen Sack zu finden glaubt. Ob aber die äufsere Haut sich
erst später über der innern bildet, h at bei Menschen, da man ein ursprünglich
glattes Ei nicht kennt, noch weniger ausgemacht werden können, als bei Raub-
thieren.U
nzweifelhaft scheint es mir aus der eigenen Beobachtung des Eies von
14 Tagen und dem von P o c k e ls beschriebenen Ei von 13 Tagen jiswelches derselbe
freilich anders deutet *), dafs auf dem innern Sacke oder vielmehr aus einem
Theile desselben,; wie bei allen andern Säugethieren, der Embryo sich .zu
bilden beginnt ([nach diesen Beobachtungen etwa 11 oder 12 Tage nach der Befruchtung),
dafs dieser Embryo sich abschnürt und so der übrige Theil des
Sackes Dottersack wird, oder diejenige Blase, welche wir im Menschen das JVa-
belbläschen nennen.
Ich glaube in derselben Beobachtung mit Sicherheit erkannt zu haben, dafs
die Keimhaut sich in ein animalisches und vegetatives Blatt trennt und dafs das
erstere den Embryo umhüllend ihm ein Amnion und eine seröse Hülle giebt, welche
letztere den Embryo mit dem Dottersacke an die äufsere Eihaut anheftet.
Diese Vorgänge sind wie in allen übrigen Säugethieren, nur fiel es mir auf,
dafs der Embryo schon so früh sich auf die Seite gedreht hatte **).
Durch diese Bemerkung aber wird es verständlich, wie schon sehr bald
der Dottersack bedeutend vom Embryo absteht und mit ihm nur durch einen dünnen
Stiel, den Dottergang, verbunden ist. Dafs dieser Dottergang ein offener
Kanal ist, glaube ich in fast allen Eiern aus den sechs ersten Wochen des Emp.
Nabelbläschen.
*) Die wegen der zahlreichen Beobachtungen aus sehr früher Zeit merkwürdigen Beobachtungen
von Dr. P o c k e ls finden sich in der Isis 1825.
♦*) Studien No. 2.