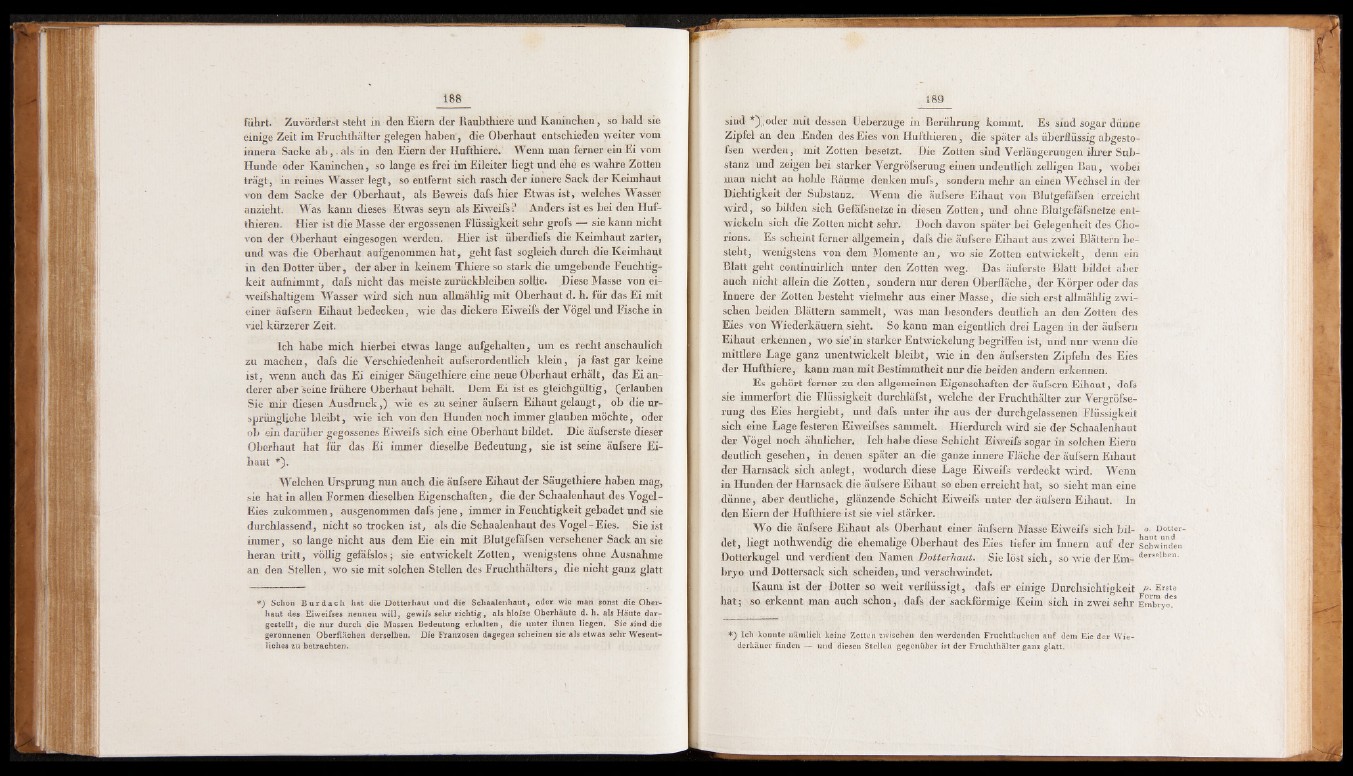
führt. Zuvörderst steht in den Eiern der Raubthiere und Kaninchen, so bald sie
einige Zeit im Fruchthälter gelegen haben', die Oberhaut entschieden weiter vom
inneru Sacke a b , - als in den Eiern der Hufthiere. Wenn man ferner ein Ei vom
Hunde oder Kaninchen, so lange es frei im Eileiter liegt und ehe es wahre Zotten
trägt, in reines Wasser legt, so entfernt sich rasch der innere Sack der Keimhaut
von dem Sacke der Oberhaut, als Beweis dafs hier Etwas ist, welches Wasser
anzieht. Was kann dieses Etwas seyn als Eiweifs ? Anders ist es bei den Huf-
thieren. Hier ist die Masse der ergossenen Flüssigkeit sehr grofs — sie kann nicht
von der Oberhaut eingesogen werden. Flier ist überdiefs die Keimhaut zarter,
und was die Oberhaut aufgenommen hat, geht fast sogleich durch die Keimhaut
in den Dotter über, der aber in keinem Thiere so stark die umgebende Feuchtigkeit
aufnimmt, dafs nicht das meiste Zurückbleiben solhe. Diese Masse von eiweifshaltigem
Wasser wird sich nun allmählig mit Oberhaut d. h. für das Ei mit
einer äufsern Eihaut bedecken, wie das dickere Eiweifs der Vögel und Fische in
viel kürzerer Zeit.
Ich habe mich hierbei etwas lange aufgehalten, um es recht anschaulich
zu machen, dafs die Verschiedenheit aufserordentlich klein, ja fast gar keine
ist, wenn auch das Ei einiger Säugethiere eine neue Oberhaut erhält, das Ei anderer
aber seine frühere Oberhaut behält. Dem Ei ist es gleichgültig, (erlauben
Sie mir diesen Ausdruck,) wie es zu seiner äufsern Eihaut gelangt, ob die ursprüngliche
bleibt, wie ich von den Hunden noch immer glauben möchte, oder
ob ein darüber gegossenes Eiweifs sich eine Oberhaut bildet. Die äufserste dieser
Oberhaut hat für das Ei immer dieselbe Bedeutung, sie ist seine äufsere Eihaut
*).
Welchen Ursprung nun auch die äufsere Eihaut der Säugethiere haben mag,
sie hat in allen Formen dieselben Eigenschaften, die der Schaalenhaut des Vogel-
Eies zukommen, ausgenommen dafs jene, immer in Feuchtigkeit gebadet und sie
durchlassend, nicht so trocken ist, als die Schaalenhaut des Vogel-Eies. Sie ist
immer, so lange nicht aus dem Eie ein mit Blutgefäfsen versehener Sack an sie
heran tritt, völlig gefäfelos; sie entwickelt Zotten, wenigstens ohne Ausnahme
an den Stellen, wo sie mit solchen Stellen des Fruchthälters, die nicht ganz glatt
*) Schon B u r d a ch hat die Dotterhaut und die Schaalenhaut, oder wie man sonst die Oberhaut
des Eiweifses nennen will, gewifs sehr richtig, als blofse Oberhäute d. h. als Häute dargestellt,
die nur durch ,die Massen Bedeutung erhalten, die unter ihnen liegen. Sie sind die
geronnenen Oberflächen derselben. Die Franzosen dagegen scheinen sie als etwas sehr Wesentliches
zu betrachten.
sind *),,oder mit dessen Ueberzuge in Berührung kommt. Es sind sogar dünne
Zipfel an den Enden des Eies von Hufthieren, die später als überflüssig abgesto-
fsen werden, mit Zotten besetzt. Die Zotten sind Verlängerungen ihrer Substanz
und zeigen bei starker Vergröfserung einen undeutlich zelligen Bau, wobei
man nicht an hohle Räume denken mufs, sondern mehr an einen Weöhsel in der
Dichtigkeit der Substanz. Wenn die äufsere Eihaut von Blutgefäfsen erreicht
wird, so bilden sich Gefafsnetze in diesen Zotten, und ohne Blutgefäfsnetze entwickeln
sich die Zotten nicht sehr. Doch davon später bei Gelegenheit des Chorions.
Es scheint ferner allgemein, dafs die äufsere Eihaut aus zwei Blättern besteht,
wenigstens von dem Momente an, wo sie Zotten entwickelt, denn ein
Blatt geht continuirlich unter den Zotten weg. Das äuferste Blatt bildet aber
auch nicht allein die Zotten, sondern nur deren Oberfläche, der Körper oder das
Innere der Zotten besteht vielmehr aus einer Masse, die sich erst allmählig zwischen
beiden Blättern sammelt, was man besonders deutlich an den Zotten des
Eies von Wiederkäuern sieht. So kann man eigentlich drei Lagen in der äufsern
Eihaut erkennen, wo sie’in starker Entwickelung begriffen ist, und nur wenn die
mittlere Lage ganz unentwickelt bleibt, wie in den äufsersten Zipfeln des Eies
der Hufthiere, kann man mit Bestimmtheit nur die beiden andern erkennen.
Es gehört ferner zu den allgemeinen Eigenschaften der äufsern Eihaut, dafs
sie immerfort die Flüssigkeit durchläfst, welche der Fruchthälter zur Vergröfserung
des Eies hergiebt, und dafs unter ihr aus der durchgelassenen Flüssigkeit
sich eine Lage festeren Eiweifses sammelt. Hierdurch wird sie der Schaalenhaut
der Vögel noch ähnlicher. Ich habe diese Schicht Eiweifs sogar in solchen Eiern
deutlich gesehen, in denen später an die ganze innere Fläche der äufsern Eihaut
der Harnsack sich anlegt, wodurch diese Lage Eiweifs verdeckt wird. Wenn
in Hunden der Harnsack die äufsere Eihaut so eben erreicht hat, so sieht man eine
dünne, aber deutliche, glänzende Schicht Eiweifs unter der äufsern Eihaut. In
den Eiern der Hufthiere ist sie viel stärker.
Wo die äufsere Eihaut als Oberhaut einer äufsern Masse Eiweifs sich bil- «■ Dotie
det, liegt nothwendig die ehemalige Oberhaut des Eies tiefer im Innern auf der schwinde
Dotterkugel und verdient den Namen Dotterhaut. Sie löst sich, so wie derEm- lierselben
bryo und Dottersack sich scheiden, und verschwindet.
Kaum ist der Dotter so weit verflüssigt, dafs er einige Durchsichtigkeit p■ Erste
hat; so erkennt man auch schon, dafs der sackförmige Keim sich in zwei sehr Emb^o?
*) Ich konnte nämlich keine Zotten zwischen den werdenden Fruchtkuchen auf dem Eie der Wiederkäuer
finden — und diesen Stellen gegenüber ist der Fruchthälter ganz glatt.