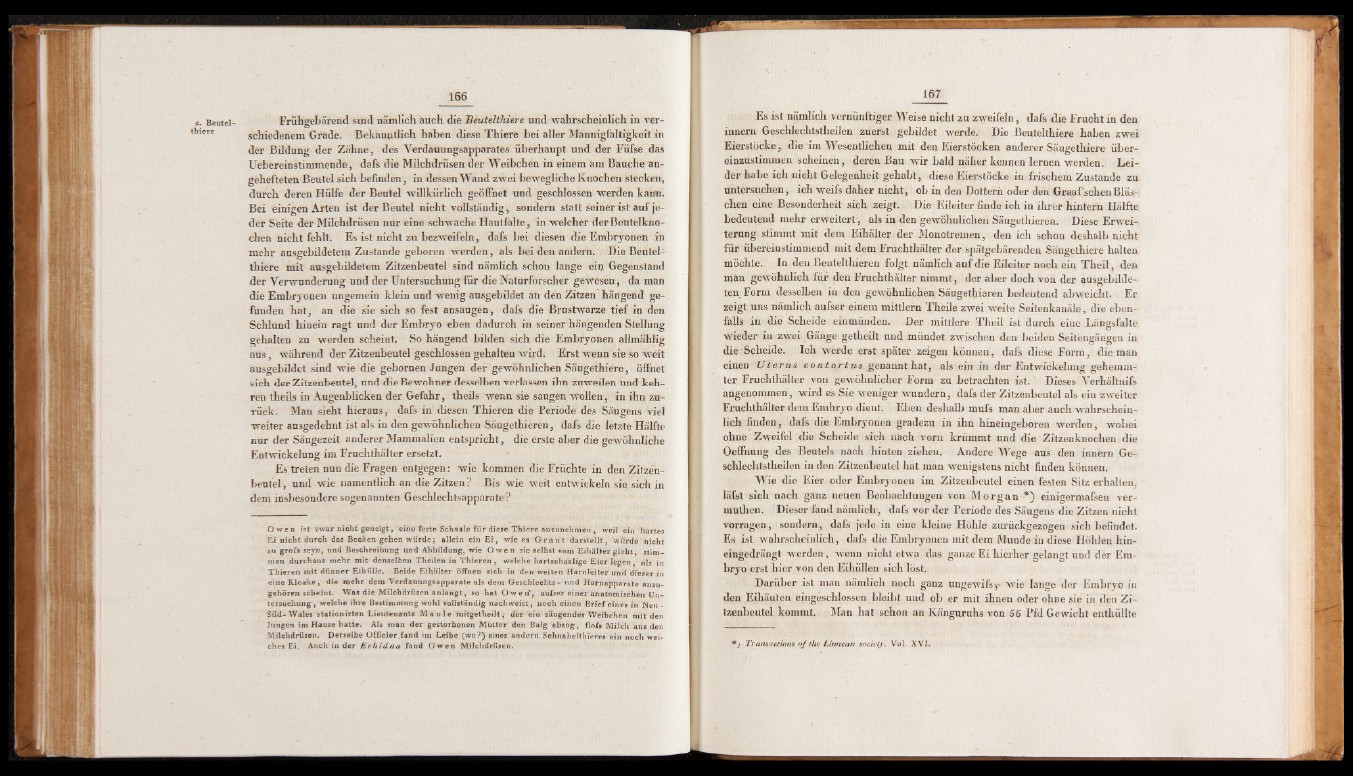
e. Beutel-
thiere
Frühgebärend sind nämlich auch die Beutelthiere und wahrscheinlich in verschiedenem
Grade. Bekanntlich haben diese Thiere bei aller Mannigfaltigkeit in
der Bildung der Zähne, des Verdauungsapparates überhaupt und der Füfse das
Uebereinstimmende, dafs die Milchdrüsen der Weibchen in einem am Bauche angehefteten
Beutel sich befinden, in dessen Wand zwei bewegliche Knochen stecken,
durch deren Hülfe der Beutel willkürlich geöffnet und geschlossen werden kann.
Bei einigen Arten ist der Beutel nicht vollständig, sondern statt seiner ist auf jeder
Seite der Milchdrüsen nur eine schwache Hautfalte, in welcher der Beutelknochen
nicht fehlt. Es ist nicht zu bezweifeln, dafs bei diesen die Embryonen in
mehr ausgebildetem Zustande geboren werden, als bei den andern. Die Beutelthiere
mit ausgebildetem Zitzenbeutel sind nämlich schon lange eil) Gegenstand
der Verwunderung und der Untersuchung für die Naturforscher gewesen, da man
die Embryonen ungemein klein und wenig ausgebildet an den Zitzen hängend gefunden
hat, an die sie sich so fest ansaugen, dafs die Brustwarze tief in den
Schlund hinein ragt und der Embryo eben dadurch in seiner hängenden Stellung
gehalten zu werden scheint. So hängend bilden sich die Embryonen allmählig
aus, während der Zitzenbeutel geschlossen gehalten wird. Erst wenn sie so weit
ausgebildet sind wie die gebornen Jungen der gewöhnlichen Säugethiere, öffnet
sich der Zitzenbeutel, und die Bewohner desselben verlassen ihn zuweilen und kehren
theils in Augenblicken der Gefahr, theils wenn sie saugen Wollen; in ihn zurück.
Man sieht hieraus, dafs in diesen Thieren die Periode des Säugens viel
weiter ausgedehnt ist als in den gewöhnlichen Säugethieren, dafs die letzte Hälfte
nur der Säugezeit anderer Mammalien entspricht , die erste aber die gewöhnliche
Entwickelung im Fruchthälter ersetzt.
Es treten nun die Fragen entgegen: wie kommen die Früchte in den Zitzenbeutel
, und wie namentlich an die Zitzen P Bis wie weit entwickeln sie sich in
dem insbesondere sogenannten Geschlechtsapparate ?
O w en ist zwar nicht geneigt, eine feste Schaale für diese Thiere artzunehmen , weil ein hartes
Ei nicht durch das Becken gehen würde; allein ein E i, wie es G r a n t darstellt, würde nicht
zu grofs seyn, und Beschreibung und Abbildung, wie O wen sie selbst vom Eihälter giebt stimmen
durchaus mehr mit denselben Theilen in Thieren, welche hartschaalige Eierlegen als in
Thieren mit dünner Eihülle. Beide Eihälter öffnen sich in den weiten Harnleiter und dieser in
eine Kloake, die mehr dem Verdauüngsapparate als dem Geschlechts- und Harnapparate anzugehören
scheint. Was die Milchdrüsén anlangt, so hat O w e if, aufser einer anatomischen Untersuchung
, welche ihre Bestimmung wohl vollständig nachweist, noch einen Brief eines in Neu -
Süd- Wales stationirten Lieutenants M a n ie mitgetheilt, dér ein säugendes Weibchen mit den
Jungen im Hause hatte. Als man der gestorbenen Mütter den Balg abzog, flofs Milch aus den
Milchdrüsen. Derselbe Officier .fand im Leibe (wo?) eines andern Scbnabelthieres ein noch weiches
Ei. Auch inder E c h id n a fand Owen Milchdrüsen.
Es ist nämlich, vernünftiger Weise nicht zu zweifeln, dafs die Frucht in den
innern Geschlechtstheilen zuerst gebildet werde. Die Beutelthiere haben zwei
Eierstöcke, die im Wesentlichen mit den Eierstöcken anderer Säugethiere übereinzustimmen
scheinen , deren Bau wir bald näher kennen lernen werden. Leider
habe ich nicht Gelegenheit gehabt, diese Eierstöcke in frischem Zustande zu
untersuchen, ich weifs daher nicht, ob in den Dottern oder den Graaf sehen Blas-,
chen eine Besonderheit sich zeigt. Die Eileiter finde ich in ihrer hintern Hälfte
bedeutend mehr erweitert , als in den gewöhnlichen Säugethieren. Diese Erweiterung
stimmt mit dem Eihälter der Monotremen, den ich schon deshalb nicht
für übereinstimmend mit dem Fruchthälter der spätgebärenden Säugethiere halten
möchte. In den Beutelthieren folgt nämlich auf die Eileiter noch ein Theil, den
man gewöhnlich für den Fruchthälter nimmt, der aber doch vou der ausgebildeten
Form desselben iu den gewöhnlichen Säugethieren bedeutend abweicht. Er
zeigt uns nämlich aufser einem mittlern Theile zwei weite Seitenkanäle, die ebenfalls
in die Scheide einmünden. Der mittlere Theil ist durch eine Längsfalte
wieder iu zwei Gänge getheilt und mündet zwischen den beiden Seitengängen iu
die Scheide. Ich werde erst später zeigen können, dafs diese Form, die man
einen Ute ru s c o n to r tu s genannt hat, als ein in der Entwickelung gehemmter
Fruchthälter von gewöhnlicher Form zu betrachten ist. Dieses Verhältnifs
angenommen, wird es Sie weniger wundern, dafs der Zitzenbeutel als ein zweiter
Fruchthälter dem Emhryo dient. Eben deshalb mufs man aber auch wahrscheinlich
finden, dafs die Embryonen gradezu iu ihn hineingeboren werden, wobei
ohne Zweifel die Scheide sich nach vorn krümmt und die Zitzenknochen die
Oeffnung des Beutels nach hinten ziehen. Andere Wege aus den innern Geschlechtstheilen
in den Zitzenbeutel hat man wenigstens nicht finden können.
Wie die Eier oder Embryonen im Zitzenbeutel einen festen Sitz erhalten,
läfst sich nach ganz neuen Beobachtungen von Mo rg an *) einigermafsen ver-
mulhen. Dieser fand nämlich, dafs vor der Periode des Säugens die Zitzen nicht
vorragen, sondern, dafs jede in eine kleine Höhle zurückgezogen sich befindet.
Es ist wahrscheinlich, dafs die Embryonen mit dem Munde in diese Höhlen hineingedrängt
werden, wenn nicht etwa das ganze Ei hierher gelangt und der Embryo
erst hier von den Eihüllen sich löst.
Darüber ist man nämlich noch ganz ungewifsy wie lange der Embryo in
den Eihäuten eingeschlossen bleibt und ob er mit ihnen oder ohne sie in den Zitzenbeutel
kommt. Man hat schon an Känguruhs von 56 Pfd Gewicht enthüllte
l'ransactions o f the Linnean society. Vol. XVI.