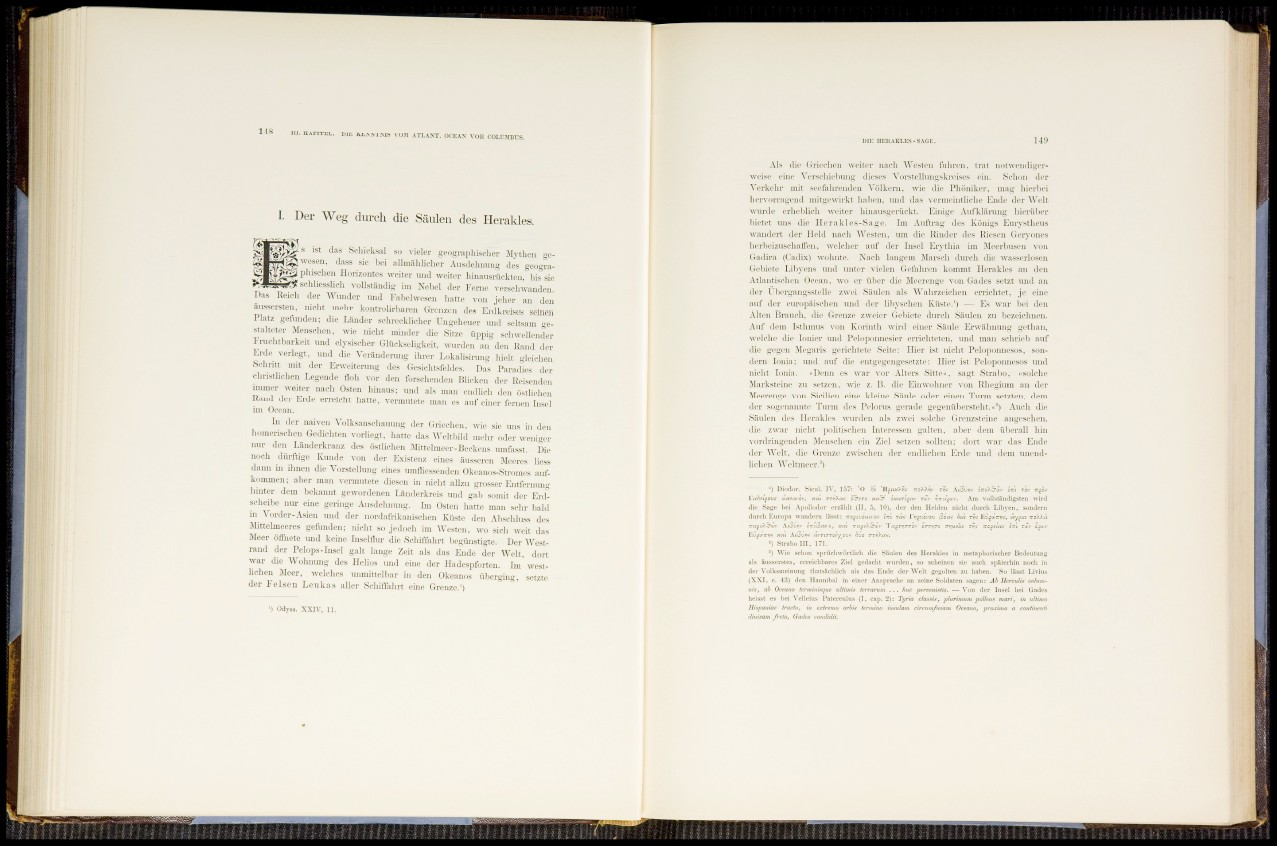
148 III. K.APITEL. DIK KEN-NTXIS V0 3 I ATL.ANT. OCEAN VOR COLUMBUS.
DIE HERAKLES-SAGE. 149
I. Der Weg durcli die Säulen des Herakles.
i s ist das Schicksal so vieler geographischer Mvtheii ge-
\wesen, dass sie bei alhnähhcher Ausdehming dés geogra-
} phischeu Horizontes weiter und weiter hinausrückten, bis sie
f schliesshch vollständig im Nebel der Ferne verschwauden
Das Reich der Wunder luid Fabelwesen hatte von jeher an den
äussersten, nicht mehr kontrolirliaren Grenzen des Erdkreises seinen
Platz gelunclen; die Länder schrecklicher Ungeheuer luid seltsam "estalteter
Menschen, wie nicht nünder die Sitze üppig scliwellender
I-ruchtbarkeit und elysischer Glückseligkeit, «airden an den Rand der
Erde verlegt, und die Veränderung ihrer Lokalisirung hielt gleichen
Schritt mit der Erweiterung des Gesichtsfeldes. Das Paratlies der
christlielien Legende floh vor den forschenden Blicken der Rei'.enden
immer weiter nach Osten lünaus; und als man endhch den ö.stlichen
Rand der Erde erreicht hatte, vermutete mau es auf einer fernen Insel
im Ocean.
Li der naiven Volksansehamuig der Grieclien. wie sie uns in den
iKunerischen Gedichten vorliegt, hatte das AVeltbild melir oder weniger
nur den Länderkranz des östlichen Mittelmeer-Beckens umfasst. Die
noch dürftige Kunde von der Existenz eines äusseren Meeres liess
dann hi ihnen die Vorstellung ehies umlliessenden Okeanos-Stromes aulkonunen;
aber man vermutete dieseu in nicht allzu grosser Entfernung
hinter dem bekannt gewordenen Länderkreis und gab somit der Erd"
scbeilie nur eine geringe Ausdehnung. Ln Osten hatte man sehr bald
m Vorder-Asien und der nordafrikanischen Küste den Abschluss des
Mittelmeeres gefunden; nicht so jedoch im Westen, wo sich weit das
Meer öffnete mid keine Inselflur die Schiffalirt begünstigte. Der Westrand
der Pelops-Insel galt lange Zeit als das Ende der Welt, dort
war die Wohnung des Helios mid eine der Iladespforten. Im' westlichen
Meer, welches unmittelbar in den Okeanos überging, setzte
der Fe l s e n Le u k a s aller Schiffahrt ehie Grenze.')
') Odys s . X X I V , 11.
Als die (n-iechen weiter nach Weslen fuhren, trat notwendigerweise
eine Ver.sehiebuiig dieses Vorstellung.skreiscs eiiL Schon der
Verkehr mit secfähreiiden A'ölkern, wie die Phöniker, mag liierbei
liervorragend mitgewirkt haben, und das vermeintliche Ende der Welt
wurde erlieblich weiter hinausgerückt. Einige Aufklärung hierüber
bietet uns die He r a k l e s -Sa g e . Im Auftrag des Königs Eurystheus
wandert der Held nach AVesten, um die Rinder des Riesen Gcryones
herbeizuschalfen. welcher auf der Insel Erytbia im Jleerbiiseii von
Gadira (Cadix) wolinte. Nach langem Alarsch durch die wasserlosen
Gebiete Liliyens nnd unter vielen Gefahren kommt Herakles an den
Atlantischen (Jcean. wo er über die Meerenge von Gades .setzt und an
der l"liergangsstelle zwei Säulen als AVahrzeicheii errichtet, je eine
auf der europäisclien und der lil)yschen Küste.') — Es war bei den
Alten Brauch, die Grenze zweier Gebiete durch Säulen zu bezeicbneii.
Auf dem Isthmus von Korinth wird einer Säule Erwähnung gethan,
welche die loiiier und Peloponiiesier errichteten, und man schrieb auf
die gegen Alegaris gerichtete Seite; Hier i.st nicht Peloponnesos, sondern
lonia; und auf die eiitgegenge.setzte: Hier ist Peloponnesos und
nicht lonia. »Denn es war vor Alters Sitte«, sagt Stralio, »solche
Alarksteine zu setzen, wie z. B. die Einwohner von Rhegium an der
Aleerenge von Sicilien eine kleine Säule oder einen Turm setzten, dem
der sog<>nannte Turm des Pelorus gerade gegenübersteht.»") Auch die
Säulen des Herakles «-urdeii als zwei solche Grenzsteine angesehen,
die zwar niclit politischen Literessen galten, alier dem überall hin
vordringenden Alcnschen ein Ziel setzen sollten; dort war das Ende
der AVeit, die Grenze zwischen der eiidhchen Erde und dem unendlichen
AVeltmeer.')
Diodor. Sicul. IV", 157: 'O Se ' I I X t ß C r i Q l;ri TÖf
r«Ssi'oou? wy.scci'ßf, ycct rrvX«^' sS-src iy.ctTiDcci' Am vollstiindigsten wi r d
die Sage tjei .Apollodor e r z ähl t (IT. 5, 10), d e r den He i d e n ni cht d u r c h L i b v e n , s o n d e r n
durch Euro] ) a wa n d e r n lässt: -ojsuoaEi'oc Irri Tag Vvis-jöi'üv ßoag Sia Tr.g E'j^uj-vic, äyoi a tto/.?.«
vra^sÄ^Mi' Ai.S'jyr STTsßai'S, yci\ 'Ya^TYjTTav sttyiTs Tyjus^ia Tyg Tto^Eiag E-i -'X'!-
EyßLi.<7Tt]g y.ai Atßv^g «i-T-tTT-oty o-jc S-jo TTy>.ag.
») S t r a b o H I . 171.
Wie schon s p r ü c l iwö r t l i c h die Säul en des He r a k l e s in me t a p i i o r i s c h e r Be d e u t u n g
als ä u s s e r s t e s , e r r e i c h b a r e s Ziel g e d a c h t w u r d e n , so s che inen sie auch s p ä t e r h i n noch in
der V'olksme inung thatsächlich als das E n d e d e r We l t gegol t en zu h a b e n . So lässt Livius
( X X I , c. 43) den Ha n n i b a l in e ine r An s p r a c h e an seine So l d a t e n s a g e n : Ab Herculis cnlumnis,
ab Oceano termhmque ultimis terrarum . . . huc pervenütis. — A'on d e r Ins e l bei Ga d e s
heisst es bei \ ' e l l e ius P a t e r c u l u s ( I , c ap. 2) : Tyria classis, plurimum pollens mari, in ultimo
Ilispaniae tractu, in e.vtremo Orbis termino insulam circumfusam Oceano, proximo a continenti
diuisam freto, Gades condidit.