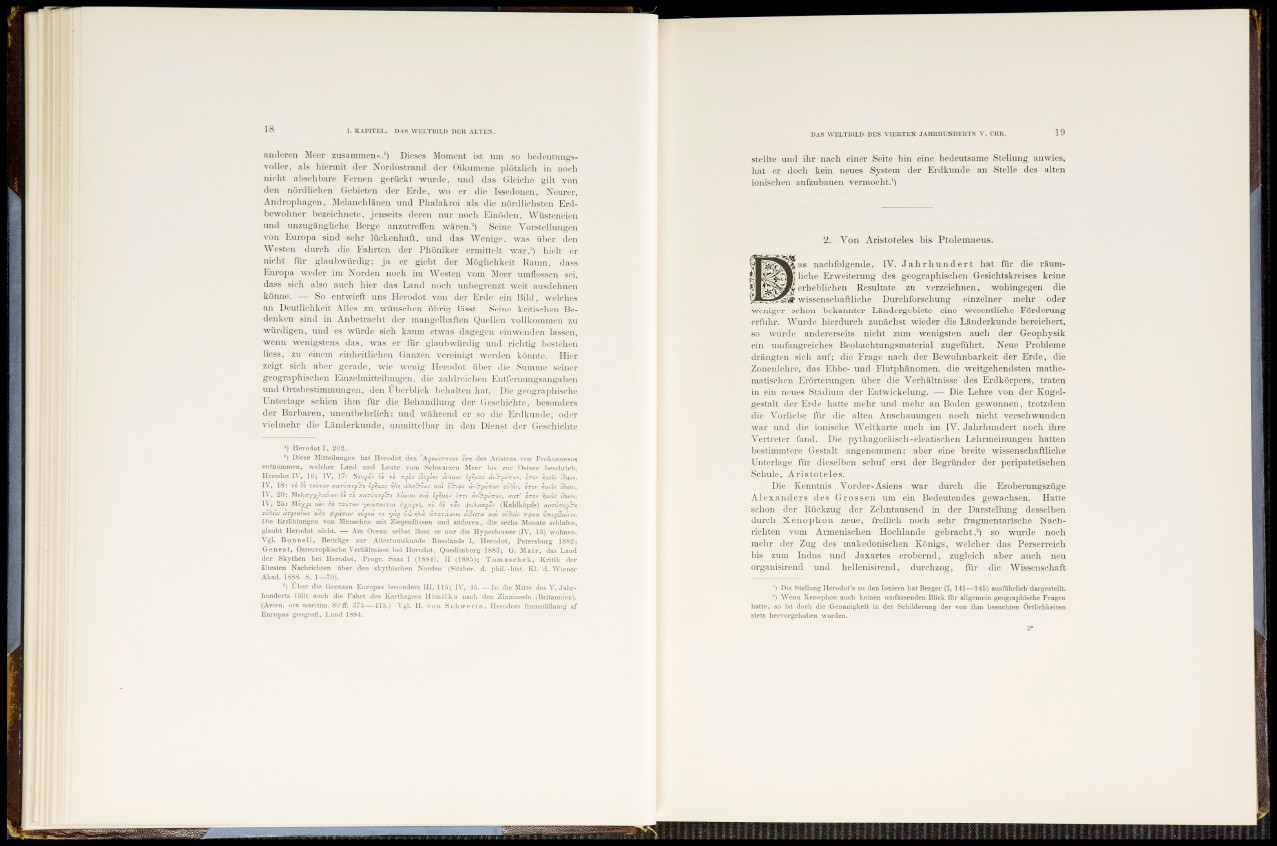
18 I. KAPITEL. DAS WELTBILD DER ALTEN. DAS WELTBILD DES VIERTEN JAHRHUNDERTS V. CHR. 1 9
amleron Meer zusammen».') Dieses Moment ist um so bedeutungsvoller,
als hiermit der Nordostrand der Oikumcne plötzlich in noch
nicht absehbare Fernen gerückt wurde, und das Gleiche gilt von
den nördlichen Gebieten der Erde, wo er die Issedonen, Neurcr,
Androphagen, Melanchliinen und Phalakroi als die nördlichsten Erdbewohner
bezeichnete, jenseits deren nur noch Einöden, Wüsteneien
und unzugängliche Berge anzutreli'en wären.') Seine Vorstellungen
von Europa sind sehr lückenhal't, und das Wenige, was über den
Westen durch die Fahrten der Pliöniker ermittelt war.') hielt er
nicht für glaubwürdig; ja er giebt der Möglichkeit Raum, dass
Europa weder im Norden noch im Westen vom l\leer umflossen sei,
dass sich also auch hier das Land noch unbegrenzt weit ausdehnen
könne. — So entwirft uns Herodot von der Erde ein Bild, welclies
an Deutlichkeit Alles zu wünschen ülu-ig lässt. Seine kritischen Bedenken
sind in Anlietracht der mangelhaften Quellen vollkommen zu
würdigen, und es "vvürde sich kaum etwas dagegen einwenden lassen,
wenn wenigstens das, was er für glaubwürdig und riclitig bestellen
liess, zu einem einlieitlichen Ganzen vereinigt werden könnte. Hier
zeigt sich aber gerade, wie wenig Herodot über die Sunnne seiner
geographischen Emzelmitteilungen, die zahlreichen Entfcnumgsangaben
und Ortsbestimmungen, den Überblick liehalten hat. Die geogra[ihisclie
Unterlage schien ihm für die Beliandlung der Geschichte, besonders
der Barbaren, unentbehrlich; und während er so die Erdkunde, oder
vielmehr die Länderkunde, unmittelbar in den Dienst der Geschichte
steUte und ihr nach einer Seite hin eine bedeutsame Stellung anwies,
hat er doch kein neues System der Erdkunde an Stelle des alten
ionischen aufzubauen vermocht.')
') He r o d o t 1, 202.
") Di e s e Mi t t e i lungen h a t He r o d o t den 'A^ t a c tm^ t a des Ar i s t e a s von P r o k o n n e s o s
entnommen, we l c h e r L a n d u n d Le u t e vom Sc hwa r z e n ]\Ieer bis z u r Os t s e e be s chr i eb.
Herodot 1 \ \ 16; ]V, 17: Neu^jwi' 6g ro t t jo? m'suov cxor' ^usi.,- iä.ufi..
IV, 18: ro Se to'j'w y.ctT^KS^-^rs Fomas^ ^Svj aXfi^i'jig y,ct\ s'S'i'OP rti'O-J^TT^i' oO^ei', otdv iSusi'.
IV, 2 0 : Ms>.(fy')(_?.«t'i'a.'i'SE TO -ACiTV-ss^s Xlui'tti ya\ l^^^uoc I m «i^S^ujttwi', yar' CTOi> ^.lEic iSasi'.
n " , 2 5 : Mä'xfi '-ii" rovrm' yimTytTitt ri S rS^ ilivf.ccy^i,' (Ka h l k o p f e )
ouö'sf? n-OSKiwQ o'i^E (p^ci-nr oC^sä vs «TOT-fiacei aßcc-u yai oCSsh npsa ins^ßau st.
Die Er z ä h l u n g e n v o n Me n s c h e n mi t Zi e g e n f ü s s e n u n d a n d e r e n , die sechs &lonate schlafen,
glaubt He r o d o t nicht. — Am Oc e an s e lbs t lässt er n u r die Hy p e r b o r e e r ( IV, 13) wo h n e n .
Vgl B o n n e l l , Be i t r äge z u r Al t e r t ums k u n d e Hu s s l a n ds I, He r o d o t , P e t e r s b u r g 1 8 8 2 ;
G e n e s t , Os t e u r o p ä i s c h e Ve rhä l tni s s e bei He r o d o t , Qu e d l i n b u r g 1 8 8 3 ; G. M a i r , da s La n d
der S k y t h e n bei He r o d o t , P r o g r . Sa a z I (1884) , II ( 1 8 8 5 ) ; T o m a s c h e k , Kr i t i k d e r
ältesten Na c h r i c h t e n ü b e r d e n s k y t h i s c h e n No r d e n (Sitzber . d. p h i l . - l ü s t . Kl. d. Wi e n e r
Akad. 1888. S. 1—7 0 ) .
Uber die Gr e n z e n E u r o p a s b e s o n d e r s 111. 115; I \ ' , 45. — In die Mi t t e des J a h r -
h u n d e r t s f ä l l t a u c h die F a h r t des Ka r t h a g e r s H i m i l k o na ch den Zinnins e ln (Br i t anni en) .
(.Avien. o r a ma r i t im. 80 tr, 375 — 415.) Vgl. I I . v o n S c h w e r i n , He r o d o t s f r ams t ä l lning af
E u r o p a s g e o g i a t i . Lu n d 1884.
2. Von Aristoteles bis Ptolemaeus.
(as nachfolgende, IV. J a h r h u n d e r t hat für die räum-
! liehe Erweiterung des geogTaphischen Gesichtskreises keine
f erheblichen Resultate zu verzeichnen, wohingegen die
' wissenschaftliche Durchforschung einzelner mehr oder
weniger schon bekannter Ländergebiete eine wesentliche Förderang
erfuhr. Wurde hierdurch zunächst wieder die Länderkunde bereichert,
so wurde andererseits nicht zum wenigsten auch der Geophysik
ein umfangreiches Beobachtungsmaterial zugeführt. Neue Probleme
drängten sicli auf; die Frage nach der Bewohnbarkeit der Erde, die
Zonenlehre, das Ebbe- und Flutphänomen, die weitgehendsten mathematischen
Erörterungen über die Verhältnisse des Erdkörpers, traten
in ein neues Stadium der Entwickelung. — Die Lehre von der Kugelgestalt
der Erde hatte mehr und mehr an Boden gewonnen, trotzdem
die A^orliebe für die alten Anschauungen noch nicht verschwunden
war und die ionische Weltkarte auch im IV. Jahrhundert noch ihre
Vertreter fand. Die pythagoräisch-eleatischcn Lehnneinungen hatten
bestimmtere Gestalt angenommen; aber eine breite wissenschaftliche
Unterlage für dieselben schuf erst der Begründer der peripatetischen
Schule, Ar i s tot e l e s .
Die Kenntnis Vorder-Asiens war durch die Eroberungszüge
Alexanders des Gr o s s e n um ein Bedeutendes gewachsen. Hatte
schon der Rückzug der Zehntausend in der Darstellung desselben
durch Xe n o p h o n neue, freilich noch sehr fragmentarische Nachrichten
vom Armenischen Hochlande gebracht,') so wurde noch
mehr der Zug des makedonischen Königs, welcher das Perserreich
bis zum Indus und Jaxartes erobernd, zugleich aber auch neu
organisirend und hellenisirend, durchzog, für die Wissenschaft
') Di e St e l lung He r o d o t ' s zu den l o n i e r n h a t Be r g e r (I, 1 4 1—1 4 5 ) a u s f ü h r l i c h da rge s t e l l t .
Wenn Xe n o p h o n auch k e i n e n umf a s s e n d e n Blick f ü r a l lgeme in g e o g r a p h i s c h e F r a g e n
h a t t e , so ist d o c h die Ge n a u i g k e i t in d e r S c h i l d e r u n g d e r von i hm b e s u c h t e n Ör t l i chke i t e n
stets h e r v o r g e h o b e n wo r d e n .