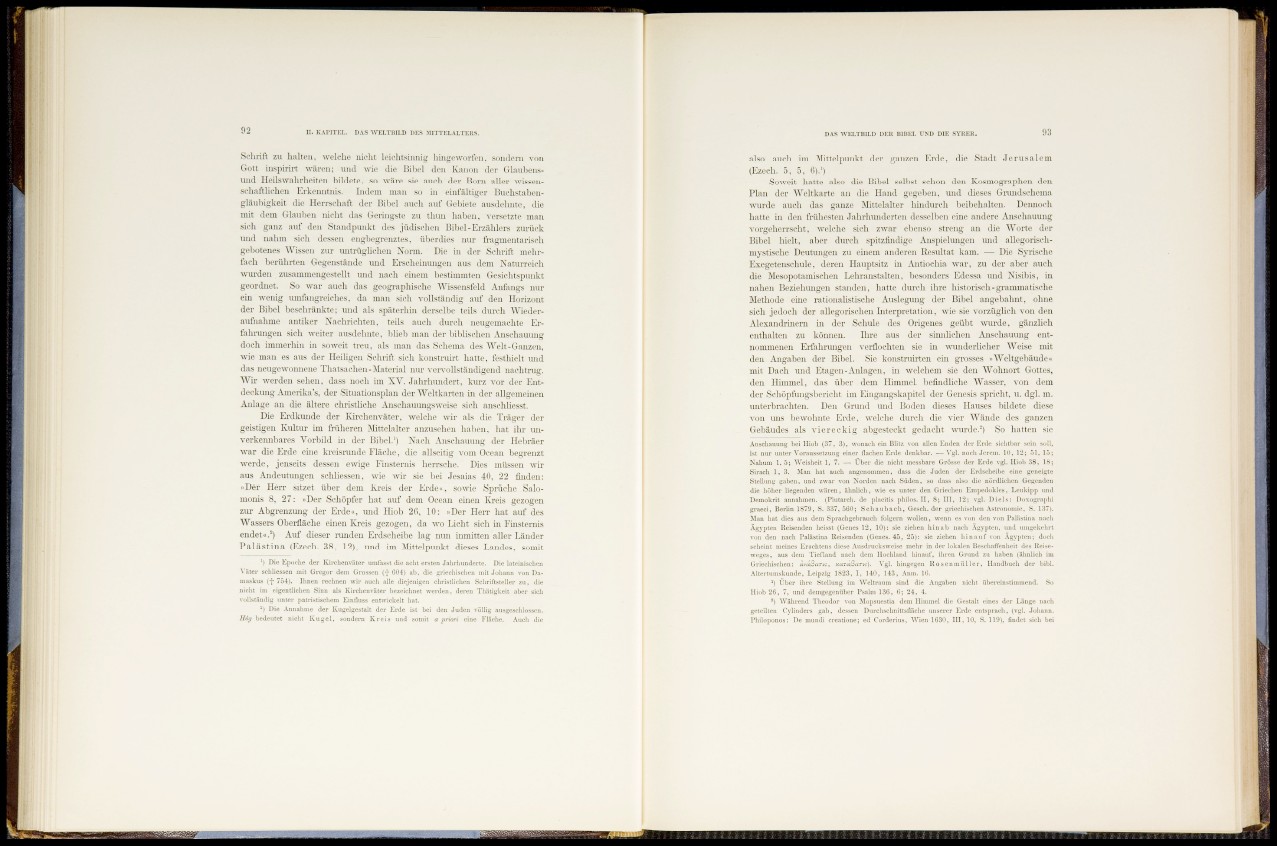
9 2 II. K.XPITKL. DAS WELTBILD DES 5IITTELALTERS. D.\S WELTBILD DER BIBEL UND DIE SYRER. 9 3
Sclirift zu lialteii. welche iiielit leiehtsiiiiiig hingeworfen, soiulerii von
Gott inspirirt wären; uiid wie die Bibel den Kanon der Glaulieiisund
ileilswahrheiten bildete, so wäre sie auch der Born aller wissenschaf'tliehen
Erkenntnis. Indem man so in einfältiger Bnehstabengläubigkeit
die Herrschaft der Bitjel auch auf Gebiete ausdehnte, die
mit dem Glauben nicht das Gering.ste zu thun haben, versetzte man
sich ganz auf den Standpunkt des jüdischen Bibel-Erzählers zurück
und nahm sich dessen engbegrenztes, überdies nur Iragmentarisch
gebotenes Wissen zur untrüglichen Nonn. Die in der Schrift mehrfach
berührten Gegenstände imd Erscheiniuigen aus dem Naturreich
wurden zusammengestellt und nach einem bestimmten Gesichtspunkt
geordnet. So war auch das geograplüsche Wissensfeld Anfangs nur
ein wemg imifangreiehes, da man sich vollständig auf den Ilorizont
der Bibel beschränkte; und als späterhin derselbe teils durch Wiederaufiiahme
antiker Nachrichten, teils auch durch neugemachte Erfalmmgen
sich weiter ausdehnte, l)lieb man der biblischen Anschammg
doch immerhin in soweit treu, als mau das Schema des Welt-Ganzen,
wie man es aus der Heiligen Schrift sich konstruirt hatte, festhielt und
das neugewonnene Thatsachen-Material nur vervollständigend nachtrug.
Wir werden sehen, dass noch im XV. Jahrhundert, kurz vor der Entdeckimg
Amerika's, der Situationsplan der Weltkarten in der allgemeinen
Anlage an die ältere christhche Anschauungsweise sich anscliHesst.
Die Erdkimde der ICirchenväter, welche wir als die Träger der
geistigen Kultur im früheren Mittelalter anzusehen haben, hat ihr miverkemibares
Vorbild in der Bibel.') Nach Anschauung der Hebräer
war die Erde eine kreisrunde Fläche, die allseitig vom Ocean begrenzt
werde, jenseits dessen ewige Finsternis herrsche. Dies müssen wir
aus Andeutmigen schliessen, wie Avir sie bei Jesaias 40, 22 finden;
»Der Herr sitzet über dem Kreis der Erde«, sowie Sprüche Salomonis
8, 27: »Der Schöpfer hat auf dem Ocean emen Kreis gezogen
zur Abgrenzung der Erde«, und Hiob 2(i, 10: »Der Herr hat auf des
Wassers Oberfläche einen Kreis gezogen, da wo Licht sich in Fmsternis
endet«.") Auf dieser runden Erdscheibe lag nun inmitten aller Länder
P a l ä s t i n a (Ezech. 38, 12), imd im Mittelpunkt dieses Landes, somit
Die Epoche der Ivirchenväter undasst die aclit ersten J ahr luinde r t e . Die Lateinisclien
Miter schliessen mit Gregor dem Grossen (-[- 604) ab. die griechischen mit Johann von Danuiskus
(•[- 754). Ihnen rechnen wi r auch alle diejenigen christlichen Schriftsteller zu, die
nicht im eigentlichen Sinn als Kirchenväter bezeichnet we r d e n , deren Thätigkeit aber sich
vollständig imter patristischem Einlluss entwickelt hat.
-) Die -•Vnnahme der Kugelgestalt der Erde ist bei den J u d e n völlig ausgeschlossen,
/ / » ^ b e d e u t e t nicht K u g e l , sondern K r e i s und somit a priori eine Fläche. Auch die
also auch im Mittelpmikt der ganzen Erde, die Stadt J e r u s a l e m
(Ezech. 5, 5, (>)•')
Soweit hatte also die Bibel selbst schon den Kosinographen den
Plan der Weltkarte an die Hand gegeben, und dieses Griuidschema
WTirde auch das ganze Mittelalter hindurch beibehalten. Dennoch
hatte in den frühesten Jahrhiniderten de.sselljen eine andere Anschauung
vorgeherrscht, welche sich zwar ebenso streng an die Worte der
Bibel hielt, aber durch spitzfindige An,spielungen und allegorischmystische
Deutiuigen zu einem anderen Resultat kam. — Die Syrische
Exegetenschule, deren Hauptsitz üi Antioehia war, zu der aber auch
die Mesopotamischen Lehranstalten, besonders Edessa nnd Nisibis, in
nahen Beziehmigen standen, hatte durch ihre historisch-grammatische
Methode eme rationalistische Auslegung der Bibel angebahnt, ohne
sich jedoch der allegorischen biterpretation, wie sie vorzüglich von den
Alexandruiern in der Schule des Origenes geübt wurde, gänzhch
enthalten zu können. Ihre aus der sünilichen Anschauung entnommenen
Erfiihrungen verflochten sie in wunderlicher Weise mit
den Angtiben der Biliel. Sie konstruirten ein grosses »Weltgebäude«
mit Dach und Etagen-Anliigen, üi welchem sie den Wolmort Gottes,
den Himmel, das über dem Himmel befindliche Wasser, von dem
der Schöpfung.sbericht im Eingangskapitel der Genesis spricht, u. dgl. m.
imterbrachten. Den Grund und Boden dieses Hauses bildete diese
von ims bewohnte Erde, welche durch die vier Wände des ganzen
Gebäudes als v i e r e c k i g al)gesteckt gedacht wurde.") So hatten sie
Anschauung bei Hiob (37, 3), wonach ein Blitz von allen Enden der Erd e sichtbar sein soll,
ist nur unte r Voraussetzung einer Ilachen Erde denkba r . — \'gl. noch J e r em. 10. 12; 51, 15;
Nahum 1. 5; We i she i t 1, 7. — Übe r die nicht messbare Grösse der Erde vgl. Hiob 3 8 . 18;
Sirach 1, 3. ^lan hat auch angenommen, dass die Juden der Erdscheibe eine geneigte
Stellung gaben, und zwar von Norden nach Sü d e n , so dass also die nördlichen Gegende n
die höhe r liegenden wä r e n , ähnl i ch, wie es unte r den Griechen Emj j edokl e s , l . eukipp nnd
Demokrit annahmen. (Plutarch. de placitis philos. I I , 8; H l , 1'2; vgl. D i e l s : Doxogr aphi
graeci, Berlin 1879, S. 337, 560; S c h a u b a c h , Geseh, der griechischen As t rononüe , .S. 137).
Man hat dies aus dem Spr a chgebr auch folgern wol l en, wenn es von den von Palästina nach
Ägypten Reisenden heisst (Genes 12, 10): sie ziehen h i n a b nach .'\gypten, und umg e k e h r t
von den nach Palästina Reisenden (Genes. 45, 25): sie ziehen h i n a u f von .'\gypten; doch
scheint meines Er a cht ens diese .Ansdrucksweise mehr in der lokalen Beschatl'euheit des Reiseweges,
aus dem Ti e f l and nach dem Hochland hinauf , ihren Gr u n d zu haben (ähnlich im
Griechischen: ai'äßuTtg, y.araßctTii;). ^'gl. hingegen R o s e n m ü l l e r . Handbuch der bibl.
Altertumskunde, Leipzig 1823, 1. 140, 143, Anm. 16.
Über ihre Stellung im We l t r a um sind die Angaben nicht übereinstinunend. So
Hiob 2 6 , 7, und demgegenüber Psalm 136, 6; 24, 4.
Während Theodor von Mopsnestia dem Himmel die Gestalt eines der Länge naeh
geteilten Cylinders g a b , dessen Diu-chscbnittstläche unserer Er d e ent spr a ch, (vgl. Johann.
Pliiloponos: De mundi creatione; ed Corderius , Wi e n 1630, HI , 10, S. 119), tindet sich bei
I