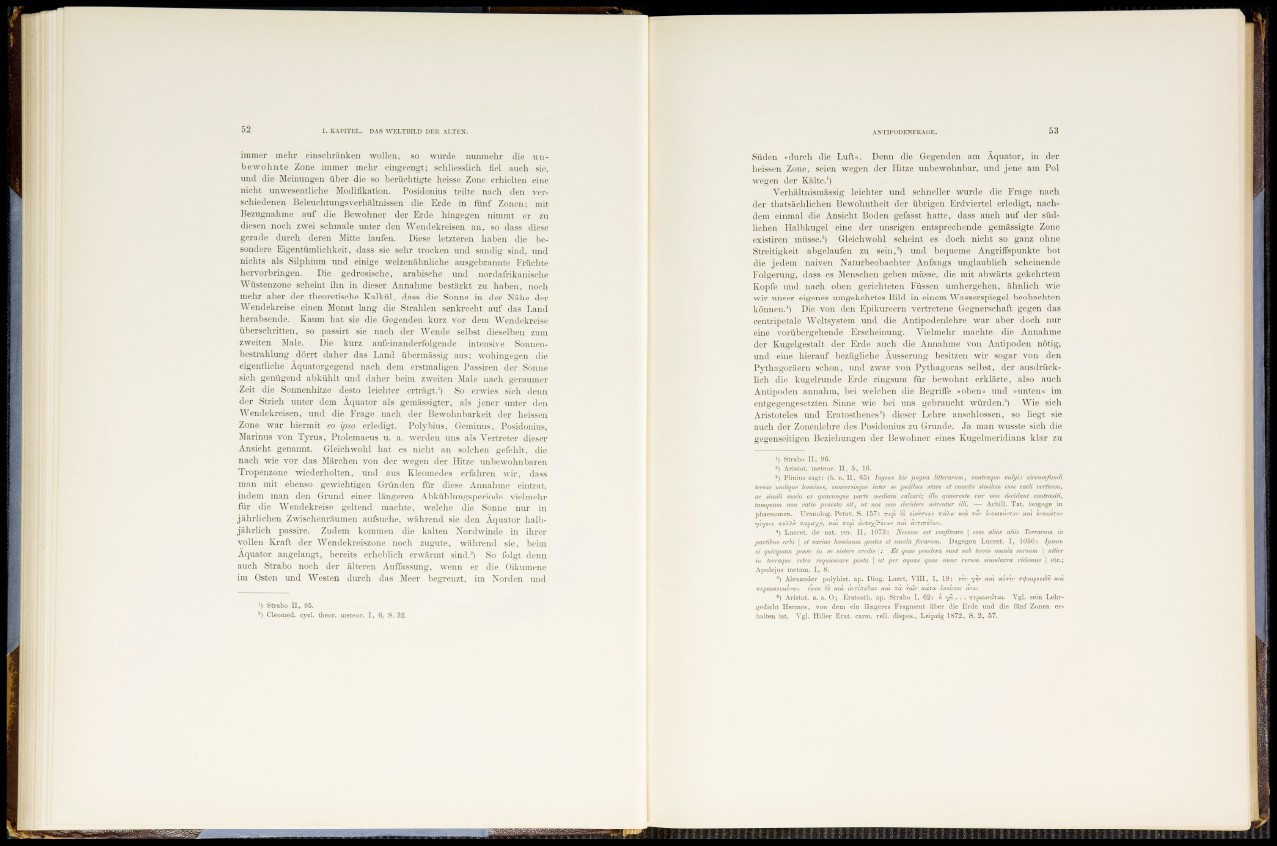
52 I. KAPITEL. DAS AVELTBILD DER ALTEN. ANTIPODENFRAGE. 53
immer mehr einscliriiiilien wollen, so wurde nunmehr die u n -
b e w o h n t e Zone hnmer mehr eingeengt; schliesslich fiel auch sie,
und die Meinungen über die so berüchtigte heisse Zone erhielten eine
nicht unwesentliche Modifikation. Posidonius teilte nach den verschiedenen
Beleuchtungsverhiiltnissen die Erde in fünf Zonen: uiit
Bezugnahme auf die Bewohner der Erde hingegen nimmt er zu
diesen noch zwei schmale miter den Wendekreisen an, so dass diese
gerade durch deren Mitte laufen. Diese letzteren haben die besondere
Eigentümlichkeit, dass sie sehr trocken und saudig sind, und
nichts als Silphium und einige weizenähnliche ausgebrannte Früchte
hervorbringen. Die gedrosische, arabische und nordafrikanische
Wüstenzone scheint ihn in dieser Annahme bestärkt zu haben, noch
mehr aber der theoretische Kalkül, dass die Sonne in der Nähe der
Wendekreise einen Monat lang die Strahlen senkrecht auf das Land
herabsende. Kaum hat sie die Gegenden kurz vor dem Wendekreise
überschritten, so passirt sie nach der Wende selbst dieselben zum
zweiten Male. Die kurz aufeinanderfolgende intensive Sonnenbestrahlung
dörrt daher das Land übermässig aus; wohingegen die
eigentliche Aquatorgegend nach dem erstmaligen Passiren der Sonne
sich genügend abkühlt und daher beim zweiten Male nach geraumer
Zeit die Sonnenhitze desto leichter erträgt.') So erwies sich denn
der Strich unter dem Äquator als gemässigter, als jener unter den
Wendekreisen, und die Frage nach der Bewohnbarkeit der heissen
Zone war hiermit eo ipso erledigt. Polybius, Geminus, Posidonius,
Marinus von Tyrus, Ptolemaeus u. a. werden uns als Vertreter dieser
Ansicht genannt. Gleichwohl hat es nicht an solchen gefehlt, die
nach wie vor das Märchen von der wegen der Hitze unbewohnbaren
Tropenzone wiederholten, und aus Kleomedes erfahren wir. dass
man mit ebenso gewichtigen Gründen für diese Annahme eintrat,
üidem man den Grund einer längeren Abkühlungsperiode vielmehr
für die Wendekreise geltend machte, welche die Sonne nur in
jährliehen Zwischenräumen aufsuche, während sie den Äquator halbjährlich
passire. Zudem kommen die kalten Nordwinde in ihrer
vollen Kraft der Wendekreiszone noch zugrite, während sie, beim
Äquator angelangt, bereits erheblich erwärmt sind.") So folgt denn
auch Strabo noch der älteren Auffassung, wenn er die Oikumene
im Osten imd Westen durch das Meer begrenzt, im Norden und
Süden »durch die Luft«. Denn die Gegenden am Äquator, in der
heissen Zone, seien wegen der Hitze unbewohnbar, und jene am Pol
wegen der Kälte.')
Verhältnismässig leichter und schneller wurde die Frage nach
der thatsäehhchen Bewohiitheit der übrigen Erdviertel erledigt, nachdem
einmal die Ansicht Boden gefasst hatte, dass auch auf der südlichen
Halbkugel eine der unsrigen entsprechende gemässigte Zone
existiren müsse.") Gleichwohl scheint es doch nicht so ganz ohne
Streitigkeit abgelaufen zu sein,") ruid bequeme Angriffspunkte bot
die jedem naiven Naturbeobachter Anfangs unglaublich scheinende
Folgerung, dass es Menschen geben müsse, die mit abwärts gekehrtem
Kopfe und nach oben gerichteten Füssen umhergehen, ähnlich wie
wir unser eigenes umgekehrtes Bild in einem Wasserspiegel beobachten
können.') Die von den Epikureern vertretene Gegnerschaft gegen das
centripetale AVeltsystem und die Antipodenlehre war aber doch nur
eine vorübergehende Erscheinung. Vielmehr machte die Annahme
der Kugelgestalt der Erde auch die Annahme von Antipoden nötig,
und eine hierauf bezügliche Äusserung besitzen wir sogar von den
Pythagoräern schon, und zwar von Pythagoras selbst, der ausdrücklich
die kugelrunde Erde ringsum für bewohnt erklärte, also auch
Antipoden annahm, bei welchen die Begriffe »oben« und »unten« im
entgegengesetzten Sinne wie bei uns gebraucht würden.") Wie sich
Aristoteles und Eratosthenes") dieser Lehre anschlössen, so liegt sie
auch der Zoneulehre des Posidonius zu Grunde. Ja man wusste sich die
gegenseitigen Beziehungen der Bewohner eines Kugelmeridians klar zu
') s t r a b o I I , 96.
'') Aristot. me t eor . I I . 5, IG.
Plinius s a g t : (h. n. I I . 65) Inyens lue pugna Htterarum, contraque vulgi: circumfundi
terrae undique homines^ conversisque inter se pedihus stare et cunetis similem esse eaeli vertieem,
ac simili modo ex quacunque parte mediam calcari; itlo quaerente cur non décidant contrasiti,
tamquam non ratio praesto sit, iit nos non decidere mirentur iäi. — Aclnll. Ta t . isagoge in
phaenomen. Ur a n o l o g . Pet.av. S. 1 5 7 : n-sai Se cly.rTs^u t^ccXh' -aul -wr ivoiyo^i'-Mi -Acti oi'ouutwv
yiyovs Î7o>.A>» -aaayj^y yut rre^i ^«Ki'T-ity^^SrSo-io".i wi' «l'Tt/ToSiJL'l'.
') S t r a b o I I , 95.
') Cl eomed. oycl. theor . me t e o r . I, G, S. 32.
Lucret. de nat . r e r . I I , 1 0 7 3 : Kecesse est conßteare 1 esse alios aliü Terrarum in
partilnis orhi \ et varias hominum genten et saecla ferarum. Da g e g e n Lu c r e t . I, 1 0 5 6 : Ipsum
si quicquam. posse in se sistere credis \ : Et quae pondera sunt sub terris omnia sursum ] nitier
in terraque retro requiescare posta \ ut per aquas quae nunc verum simulacra videmus \ etc.;
.Apulejus me t am. I, 8.
Alexander polyhi s t . aj). Diog. La e r t . V l l I , 1, 19: -ri' 7'ïi' neu
TTSûICIXOtJwÉfïlI'. £ll'«t Se ««I «It/tToS«? ««[ T« YIMf HUTW ly.SlVOlQ fCI'UJ.
Aristot. a. a. O; Er a t o s t h . ap. S t r a b o I, 6 2 : r y^ . . . T^s^ioiy.CtTctt, Vgl . sein Le h r -
gedicht He rme s , von d em ein l änge r e s F r a gme n t ü b e r die E r d e u n d die f ü n f Zo n e n e r -
halten ist. Vgl, Hi l l e r Er a t . c a rm. reih dispos., Le i p z i g 1 8 7 2 , S. 2, 57.
ei