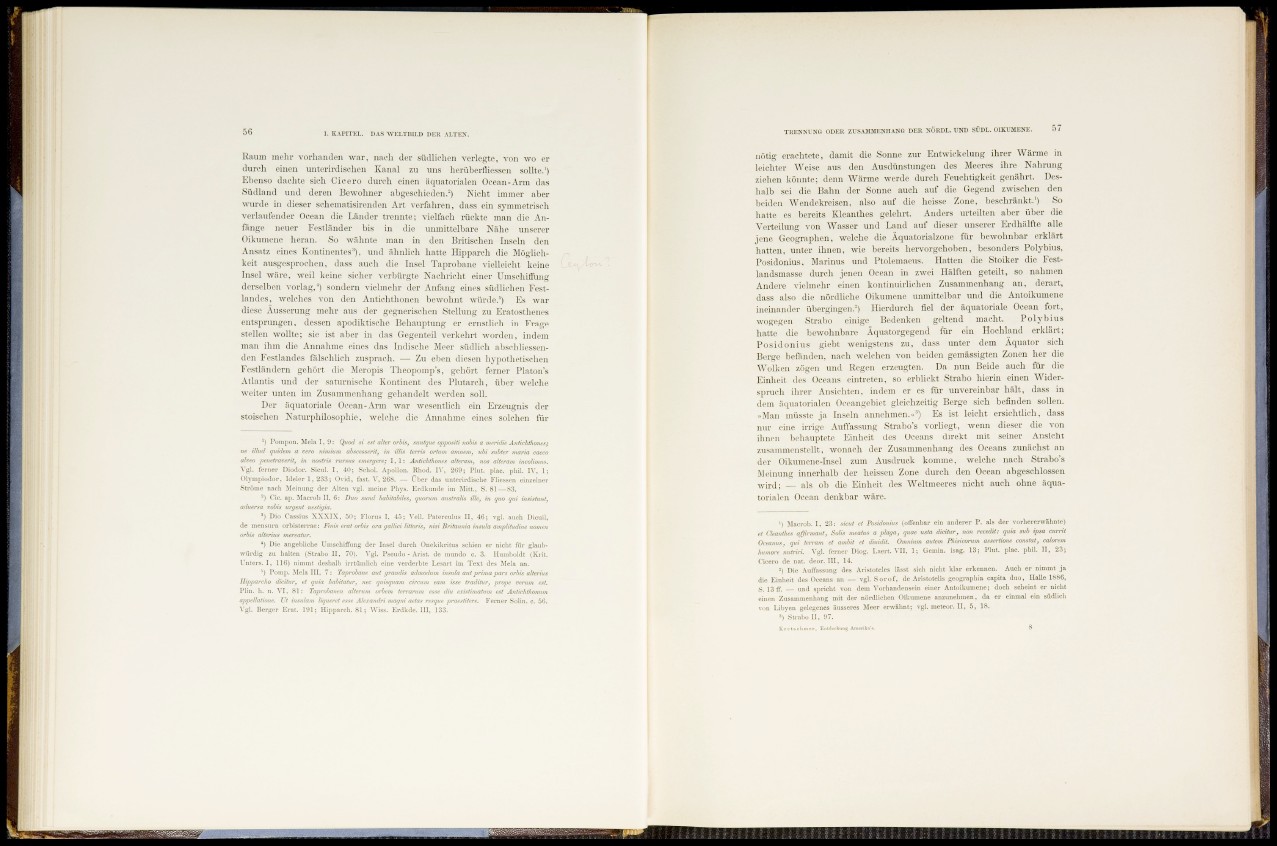
5G I. KAPITKL. DAS WELTBILD DER ALTEN.
Raum mehr vorluinden war, naeh der südhchen verlegte, A'on wo er
durch einen unterirdischen Kanal zu uns herüberfliessen sollte.')
Ebenso dachte sich Cicero durch ehien äquatorialen Ocean-Arm das
Südland und deren Bewohner abgeschieden.-') Nicht immer aber
wrn-de in dieser schematisirenden Art verfahren, dass ein synnnetrisch
verlaufender Ocean die Länder trennte; vielfach rückte man die Anfiinge
neuer Festländer bis in die unmittelbare Nähe unserer
Oikumene heran. So wähnte man in den Britischen Liseln den
Ansatz ehies Konthientes"), und ähnlich hatte Hipparch die ßlöglichkeit
ausgesprochen, dass auch die Insel Taprobane vielleicht keine
Insel Aväre, Aveil keine sicher verbürgte Nachricht einer Umschifi'ung
derselben vorlag,') sondern vielmehr der Anfang eines südlichen Festlandes,
welches von den Antichthonen bewohnt würde.") Es war
diese Äusserung mehr aus der gegnerischen Stellung zu Eratosthenes
entsprungen, dessen apodiktische Behauptung er ernstlich in Frage
stellen wollte; sie ist aber in das Gegenteil verkehrt worden, indem
man ihm die Annahme eines das Indische Meer südlich abschliessenden
Festlandes fälschlich zusprach. — Zu eben diesen hypothetischen
Festländern gehört die Meropis Theopomp's, gehört ferner Platon's
Atlantis und der saturnische Kontinent des Plutarch, über welche
Aveiter imten im Zusammenhang gehandelt Averden soll.
Der äquatoriale Ocean-Arm war wesenthch ein Erzeugnis der
stoischen Naturphiloso])hie, welche die Ainiahme eines solchen für
Pompon. Mela 1 , 9 : Quod si est alter Orbis, suntque qpjwsiti nobis a rnmdie Antichthones;
ne ilhrd quidem a vera nimium abscesserit, in Ulis terris orhnn arnnem, uhi subter maria caeco
alveo penetraverit, in tiosfris ritrsns emenjere; 1 . 1 : Aniichthones alteram, nos alteram incolimits.
A'gl. f e rne r Diodor. Sieul. I. 4 0 ; Seliol. Apollon. Rhod. IV. 269; Pint. plac. pliil. IV, 1;
Olynipiodor. Ideler I, 2 3 3 ; Ovid, fast. A", 268. — l''ber das unterirdisclie Fliessen einzelner
StrBnie nach Aleinnng der Alten vgl. ineine Phys. Er d k u n d e im l l i t t . , S. 8 1—8 3 .
Cic. a]>. Macrob II, 6: Duo sitnd habitabiles, quorum ausiralis ille, in quo qui insistant,
aduersa vobis urgent ue^tiyia.
Bio Cassins X X X I X , 50; Florns I. 4 5 ; Veil. Paterculus I I , 4 6 ; vgl. anch Dicidl,
de inensnra orbi s t e r r a e: Finis erat Orbis ora gallici littoris, nisi Britannia insula amplitudins nomen
Orbis alterius mereatur.
Die angebliche Unischiffnng der Insel dur ch Onekikritus schien er nicht für glaubwürdig
zu halten (Strabo I I , 70). A'gl. Ps eudo - Arist. de mundo c. 3. Kiunboldt (Krit.
I ' n t e r s. I. 116) nimmt deshalb irrtümlich eine ve rde rbt e Lesart im Te x t des ßlela an.
Pomp. Alela III. 7: Taprobane a-ut grandis admoâurn insida aid prima pars Orbis alterius
Jlipparclto dicitur, et quia habitatur, nec quisqvam circum earn isse traditur, prope verum est.
Plin. h. n. A'I. 81 : Taprobanen alteram orbem terrarum esse diu existimatum est Anticlithonum
appellatione. Ut insulam liqueret esse Alexandri rnatjni aetas resque ^iraestitere. Fe rne r Solin. c. 56.
Vgl. Berger Er a t . 191; Hippa r ch. 81 ; Wi s s . Erdkde , III, 133.
TRENNUNß ODER ZUSAMMENHANG DER KÖRDL. UND SÜDL. OIKUMENE. 57
nötig erachtete, damit die Sonne zur Entwickelung ihrer 'Wärme in
leichter Weise aus den Ausdünstungen des Meeres ihre Nahrung
ziehen könnte; denn Wärme werde durch Feuchtigkeit genährt. Deshalb
sei die Bahn der Sonne auch auf die Gegend zwischen den
beiden Wendekreisen, also auf die heisse Zone, beschränkt.') So
hatte es bereits Kleanthes gelehrt. Anders urteilten aber über die
Verteilung von Wasser und Land auf dieser unserer Erdhälfte alle
jene Geographen, welche die Äquatorialzone für bewohnbar erklärt
hatten, unter ihnen, wie bereits hervorgehoben, besonders Polybius,
Posidonius. Marinus und Ptolemaeus. Hatten die Stoiker die Festlandsmasse
durch jenen Oeean in zwei Hälften geteilt, so nahmen
Andere vielmehr einen kontinuirlichen Zusammenhang an, derart,
dass also die nördliche Oikumene unmittelbar und die Antoikumene
ineinander übergingen.") Hierdurch fiel der äquatoriale Oeean fort,
wogegen Strabo einige Bedenken geltend macht. P o l y b i u s
hatte die bewohnbare Äquatorgegend für ein Hochland erklärt;
P o s i d o n i u s giebt wenigstens zu, dass unter dem Äquator sich
Berge befanden, nach welchen von beiden gemässigten Zonen her die
Wolken zögen und Regen erzeugten. Da nun Beide auch für die
Einheit des Oceans eintreten, so erblickt Strabo hierin einen Widerspruch
ihrer Ansichten, indem er es für unvereinbar hält, dass in
dem äciuatorialen Oceangebiet gleichzeitig Berge sich befinden sollen.
»Man müsste ja Inseln annehmen.«") Es ist leicht ersichtlich, dass
nur eine irrige Auffassung Strabo's vorliegt, wenn dieser die von
ihnen behauptete Einheit des Oceans direkt mit seiner Ansicht
zusammenstellt, wonach der Zusammenhang des Oceans zunächst an
der Oikumene-Insel zum Ausdruck komme, welche nach Strabo's
Meinung innerhalb der heissen Zone durch den Oeean abgeschlossen
wird; — als ob die Einheit des Weltmeeres nicht auch ohne äquatorialen
Oeean denkbar wäre.
Alacrob. I, 23 : sicut et Posidonivs (offenbar ein ande r e r P. als der vorhe r e rwähnt e )
et Cleantlus affirmant, Solis meatus a plaga, quae usta dicitur, non recedit: quia sub ipsa currit
Oeeanus. qui terram et ambit et dimlit. Omnium autem FUsicorum asseriione constat, calorem
humore nutriri. Vgl. ferner Diog. Laert. VII, 1; Gemin. isag. 13; Plut. plac, phil. I I , 23;
Cicero de nat, deor. Hl . 14.
-) Die Auffassung des Aristoteles lässt sich nicht kl ar e rkennen. Auch er nimmt ja
die Einheit des Oceans an — vgl. S o r o f , de Aristotelis geographi a capita d u o , Halle 1886,
S, 13 (f. und spricht von dem Vorhandensein einer Antoikumene ; doch scheint er nicht
einen Zus ammenhang mit der nördlichen Oikumene anzunehmen , da er einmal ein südlich
von Libyen gelegenes äusseres Meer e rwä h n t ; vgl. meteor. I I , 5, 18.
=) Strabo I I , 97.
Ivr 0 Cä etimer, Entiiopkunq .\meril(.-i's.
te
i ' t t i i t l i j y M i i i l l i i •i i i l i . i O fcÏ-.Ï Ii 1