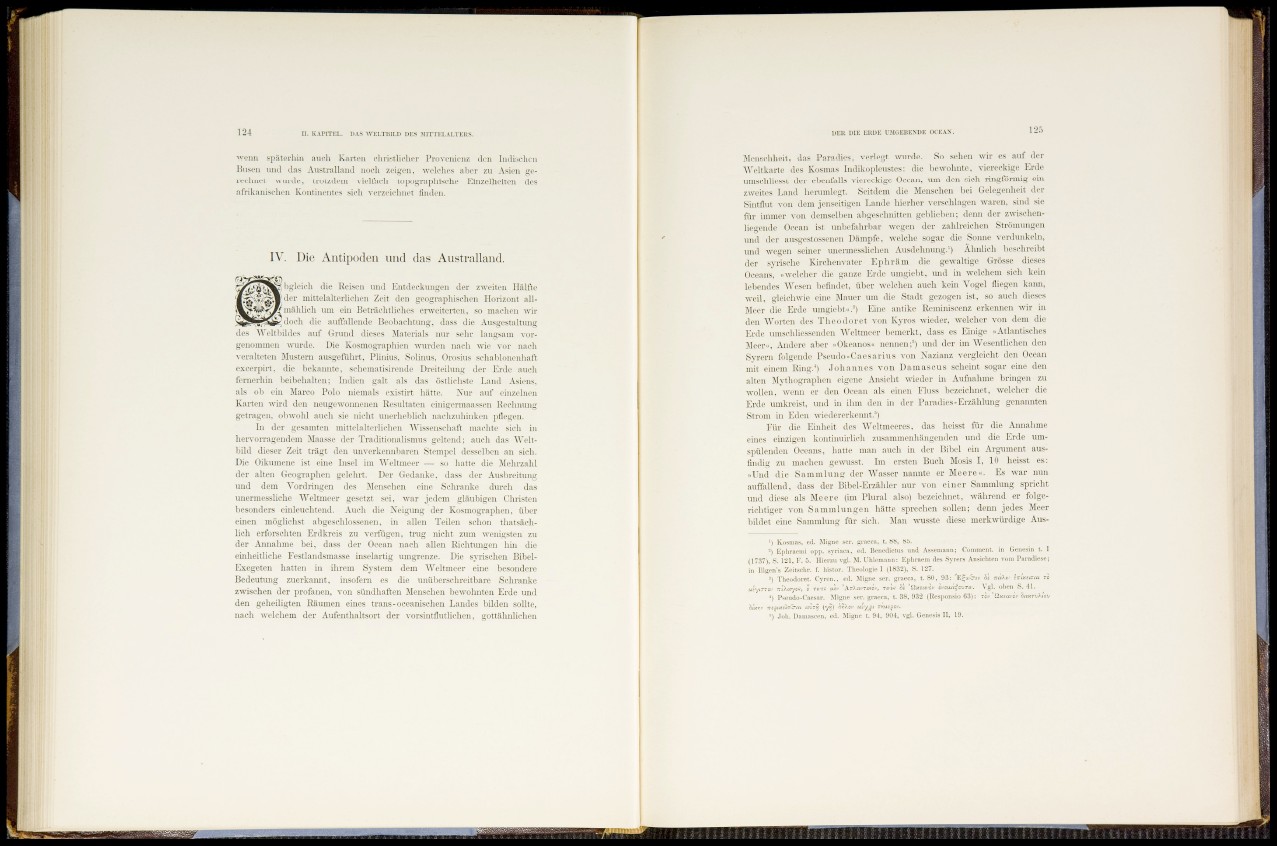
124 II. KAr iTKL. DAS WELTBILD DES 3IITTELALTEI!S.
wenn späterhin auch Karten christlieher PrüAenienz den Indischen
Bnsen nnd das Australland noch zeigen, welches aber zu Asien gerechnet
A^^u•de, trotzdem A-iellach topographische Einzelheiten des
ai'rikanischen Kontinentes sich A-erzeichnet linden.
IV. Die Antipoden und das Australland.
^bgleich die Reisen und Entdeckungen der ZAveiten Hälfte
fder mittelalterlichen Zeit den geographischen Horizont all-
^mähhch um ein Beträchtliches erweiterten, so machen Avir
; doch die auflallende Beoljachtung, dass die Ausgestaltung
des "Weltbildes auf Grund dieses Materials nur sehr langsam A'orgenommen
Avurde. Die Kosmograpliien wurden nach Avie Aor nach
veralteten Mustern ausgeführt, Plinius, Solinus. Orosius schablonenhaft
excerpirt, die bekannte, schematisirende Dreiteilung der Erde auch
fernerhin beibehalten; Lidien galt als das östlichste Land Asiens,
als ob ein ILarco Polo niemals existirt hätte. Xur auf einzelnen
Karten Avird den iieugeAA^onnenen Resultaten einigermaassen Rechnung
getragen, obwohl auch sie nicht unerheblich nachzuhinken pllegen.
In der gesamten mittelalterlichen Wissenschaft machte sich in
lierA-orragendem Maasse der Traditionalismus geltend; auch das AA'eltbild
dieser Zeit trägt den unA-erkennbaren Stempel desselben an sich.
Die Oikumene ist eine Insel im Weltmeer — so hatte die Mehrzahl
der alten Geographen gelehrt. Der Gedanke, dass der Ausbreitung
und dem Tordrhigen des Menschen eine Schranke durch das
unermessliche Weltmeer gesetzt sei, Avar jedem gläubigen Christen
besonders eudeuchtend. Auch die Keigung der Kosmographen, ülier
einen möglichst abgeschlossenen, in allen Teilen schon thatsächlich
erforschten Erdkreis zu verfügen, trug nicht zum Avenigsten zu
der Ajuiahme bei, dass der Ocean nach allen Richtmigen hin die
einheitliche Festlandsmasse inselartig umgrenze. Die SAfischen Bibel-
Exegeten hatten in ihrem System dem Weltmeer eine besondere
Bedeutmig zuerkamit, uisofern es die unüberschreitbare Schranke
zwischen der profanen, A'on sündhaften Menschen beAvohnten Erde und
den geheiligten Räumen eines trans - oceanischen Landes Ijilden sollte,
nach Avelchem der Aufenthaltsort der vorsintfluthchen, gottähnlichen
DEK DIE ERDE UMGEBENDE OCEAN. 125
Menschheit, das Paradies, verlegt Avurde. So sehen wir es auf der
"\A'eltkarte des Kosmas Lidikopleustes: die beAvohnte, viereckige Erde
umschliesst der ebenfalls viereckige Ocean, um den sieh ringförmig ein
zweites Land herumlegt. Seitdem die Menschen bei Gelegenheit der
Shitflut von dem jenseitigen Lande hierher verschlagen Avaren, sind sie
für immer von demselben abgeschnitten geblieben; deim der zAvisclienliegende
Ocean ist unbefalirljar Avegen der zahlreichen Strönuuigen
und der ausgestossenen Dämpfe, Avelehe sogar die Sonne verdunkeln,
und Avegen seiner luiermesslichen Ausdehmmg.') Ähnlich lieschreibt
der syrische Kirchenvater E p h r am die geAvaltige Grösse dieses
Oceans, i-Avelcher die ganze Erde umgiebt, und in Avelchem sich kein
lebendes Wesen befindet, über welchen auch kein Vogel fliegen kami,
Aveil, gleichAvie eine Iilauer um die Stadt gezogen i.st, so auch dieses
JMeer die Erde umgiebt«.') Eine antike Remüüscenz erkeimen Avir in
den Worten des T h e o d o r e t von Kyros wieder, Aveleher von dem die
Erde umschliessenden Weltmeer bemerkt, dass es Einige »Atlantisches
Meer«, Andere alier »Okeanos« nennen;') und der im Wesentlichen den
Syrern folgende Pscudo-Caesa r ius von Nazianz vergleicht den Ocean
mit einem Ring.') J o h a n n e s v o n Dama s c u s seheint sogar eme den
alten Mythographen eigene Ansicht A\deder in Aufnahme bringen zu
Avollen, Avenn er den Ocean als einen Fluss bezeichnet, Avelcher die
Erde umkreist, und in ihm den ui der Paradies-Erzählung genannten
Strom in Eden Aviedererkennt.')
Für die Einheit des Weltmeeres, das heisst für die Aimahme
eines einzigen koutinuirlich zusammenhängenden und die Erde umspülenden
Oceans, hatte man auch in der Bibel ein Ai-gument ausfindig
zu machen geA\-usst. Im ersten Buch Mosis I, 10 heisst es;
»Und die S amml u n g der Wasser naiuite er Me e r e«. Es Avar nun
auffallend, dass der Bibel-Erzähler nur von e ine r Sammlung spricht
und diese als Me e r e (im Plural also) bezeichnet, Avährend er folgerichtiger
von S amml u n g e n hätte sprechen solleu; denu jedes Meer
bddet enie Sammlung für sich. Man Avusste diese merkAvüi-dige Aus-
Kosnias, ed. Migne ser. gr a e c a , t. 88, 85.
-) Ep h r a e t n i o p p . s y r i a c a , ed. Bc n e d i c t u s u n d As s ema n n ; Comme n t , in Gene s in t. 1
(1737), S. 121, F. 5. I l i e r zu vgl. M. Ul i l ema n n : Ep h r a e n i de s S y r e r s Ans i chi en v om P a r a d i e s e ;
in Illgen's Ze i t s chr . l'. hi s tor . Th e o l o g i e I (1832), S. 127.
3) Th e o d o r e t . Cy r c n . . ed. 31igne s e r . gr a e c a , t. 8 0 , 9 3 : "'E^aic-ïi' és 7r«?.ii' IttI-autui to
usyi—oi' 7r5X«7oc, c T^l'5^- usi- 'Ar/.c(\'7i>{cv, rirstr ès 'P.xeco'cu ovcw^oijTiy. Vgl. oben S. 41.
*) Ps e u d o -Ca e s a r . Mi g n e s e r . gr a e c a , t. 38, 932 (Re s p o n s io 6 3 ) : ror 'ilnsauci'hcty-vXlov
hly.rr •TTSJixHT^cd (7^) èvAoi' wr/^ci tym^ocw
Joh. Dama s c en , ed. Mi g n e t. 94, 904, vgl. Gene s i s 11, 19.
m