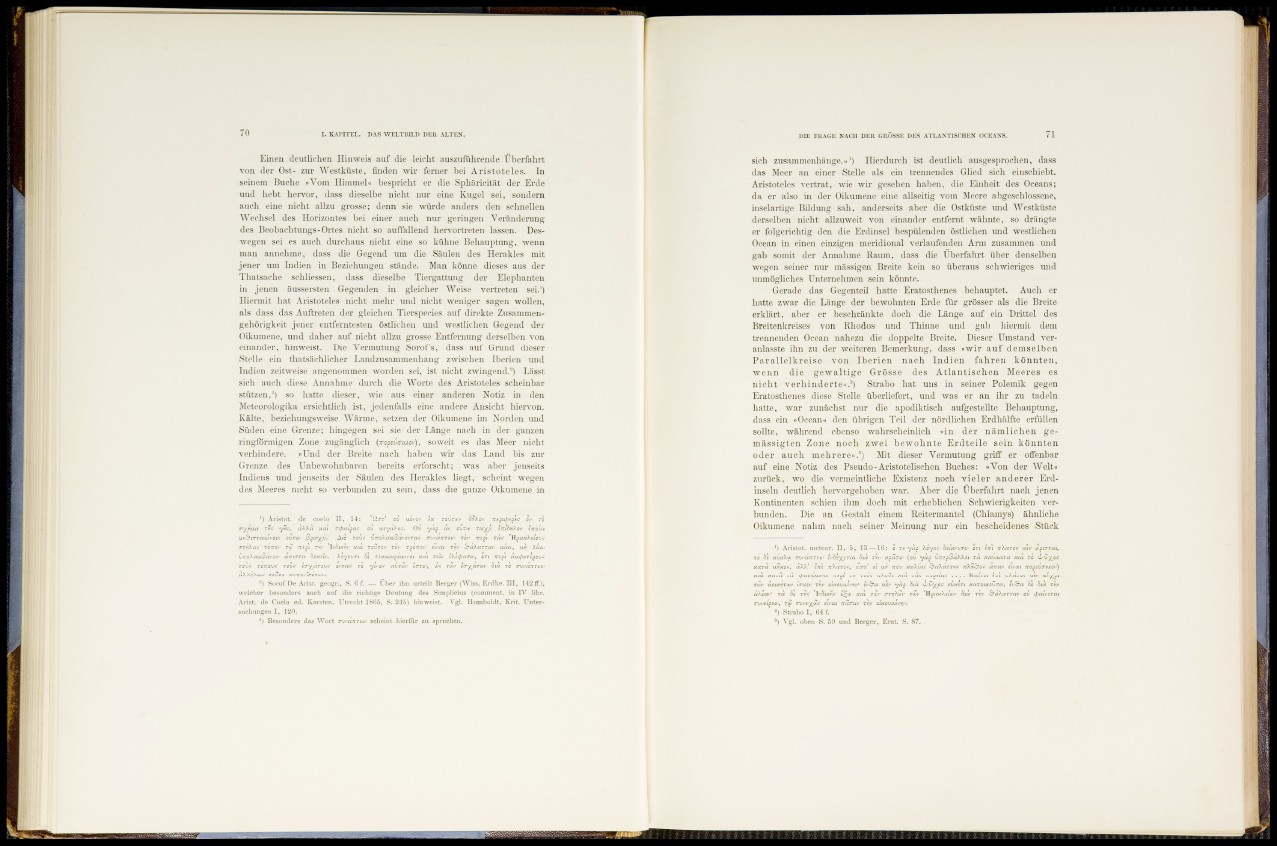
70 I . KAPITEL. DAS WELTBILD DER ALTEN. DIE FRAGE NACH DER GROSSE DES ATLANTISCHEN OCEANS. ( 1
Einen dentlichen Hinweis auf die leicht auszuführende überfahrt
von der Ost- zur Westküste, finden wir ferner bei Ar i s tot e l e s . In
seinem Ruche »Yom Himmel« bespricht er die Sphäricitiit der Erde
und hebt hei-vor, dass dieselbe nicht nur eine Kugel sei, sondern
auch eine nicht allzu grosse; denn sie würde anders den schnellen
Wechsel des Horizontes bei einer auch nnr geringen Veränderung
des Beobachtungs-Ortes nicht so auffallend her\'ortreten lassen. Deswegen
sei es auch durchaus nicht eine so kühne Behauptung, wenn
man annehme, dass die Gegend um die Säulen des Herakles mit
jener um Indien in Beziehungen stände. Man könne dieses aus der
Thatsache schliessen, dass dieselbe Tiergattung der Elephanten
in jenen äussersten Gegenden in gleicher Weise vertreten sei.')
Hiermit bat Aristoteles nicht mehr und nicht weniger sagen wollen,
als dass das Auftreten der gleiclien Tierspecies auf direkte Zusammengehörigkeit
jener entferntesten östlichen und westlichen Gegend der
Oikumene, und daher auf nicht allzu grosse Entfernung derselben von
einander, hinweist. Die Vermutung Sorof's, dass auf Grund dieser
Stelle ein thatsächlicher Landzusammenhang zwischen Iberien und
Indien zeitweise angenommen worden sei, ist nicht zwingend.') Lässt
sich auch diese Annahme durch die Worte des Aristoteles scheinbar
stützen,') so hatte dieser, wie aus einer anderen Notiz in den
Meteorologika ersichtlich ist, jedenlalls eine andere Ansicht hiervon.
Kälte, beziehungsweise Wärme, setzen der Oikumene im Norden und
Süden eine Grenze; hingegen sei sie der Länge nach in der ganzen
ringförmigen Zone zugänglich {-opsvuiacv), soweit es das Meer nicht
verhindere. »Und der Breite nach haben wir das Land bis zur
Grenze des Unbewohnbaren bereits erforscht; was aber jenseits
Indiens und jenseits der Säulen des Herakles liegt, scheint wegen
des Meeres nicht so verbunden zu sein, dass die ganze Oikumene in
') . \ n s t o t . de coelo I I . 1 4 : !;:r7'
try»;u« y^^, ci?.}.cc yai Ttpcei^aQ ov as-yfiJ.vjc. O'j
Tc'jr'jiv oi' 70
ohTM 1-KOUI
Aio rc^': •Zrzc'AwxßavovTct'^ 7'jvcc~~Et]' -01' ttfoi T«,'
Torroi' T7tst Tri' Ivdf^yi' Hai ro-jroi' TOi' toottvi' svut 7r,t' ^rcü.ctrrat' uitri', uv; ?.if(i'
• 1 - 0 / w x ß a v s » ' ä n i j -Tc i §(/>;sTj'. hs r s a a c c i o o a n ' o t y.a) TOK ;?.;(/iKT(i', 071
TO-jg roTTO'^g rovc TC fc^r'Zi' ETrty, ig r'Zi' Si« To o-i/m77rsii'
LO.y.y}.0ig TO'JTO TrSTror-Croraii'.
') Soi'of De Ar i s t . geogr . , S. 6 f. — Üb e r ihn nr t e i l t Be r g e r (Wi s s . E r d k e . I I I , 142ir.),
welcher b e s o n d e r s auch auf die r i cht ige De u t u n g de s Simpliciiis ( c omme n t . in IV libr.
Arist. de Coelo ed. Ka r s t e n . Ut r e c h t 1865. S. 245) hinwe i s t . \ ' g l . Humb o l d t , Kr i t . Un t e r -
suchungen I, 120.
Besonders da s Wo r t Tvi'a~7sti' s ehe int h i e r f ü r zu s p r e c h e n .
sich zusammenhänge.«') Ilierdurch ist deutlich ausgesprochen, dass
das Meer an einer Stelle als ein tremiendes Glied sich einschiebt.
Aristoteles vertrat, wie wir gesellen haben, die Ehiheit des Oceans;
da er also in der Oikumene eine allseitig vom Meere abgeschlossene,
inselartige Bildung sah, anderseits aber die Ostküste und Westküste
derselben nicht allzuweit von einander entfernt wähnte, so drängte
er folgerichtig den die Erdinsel bespülenden östlichen und westlichen
Ocean in einen einzigen meridional verlaufenden Arm zusammen und
gab somit der Annahme Raum, dass die Überfahrt über denselben
wegen seiner nur mässigen Breite kein so überaus schwieriges und
unmögliches ünternehmen sein kömite.
Gerade das Gegenteil hatte Eratosthenes behauptet. Auch er
hatte zwar die Länge der bewohnten Erde für gTÖsser als die Breite
erklärt, aber er beschränkte doch die Länge auf ein Drittel des
Breitenkreises von Rhodos und Thinae und gab hiermit dem
trennenden Ocean nahezu die doppelte Breite. Dieser Umstand veranlasste
ihn zu der weiteren Bemerkung, dass »wir auf d ems e l b e n
P a r a l l e l k r e i s e von I b e r i e n n a c h I n d i e n f a h r e n k ö n n t e n ,
wenn die g ewa l t i g e Grös s e des At l a n t i s c h e n Me e r e s es
nicht ve rhinde r t e«. - ) Strabo hat uns in seiner Polemik gegen
Eratosthenes diese Stelle überliefert, und was er an ihr zu tadeln
hatte, war zunächst nur die apodiktisch aufgestellte Behauptung,
dass ein »Ocean« den übrigen Teil der nördlichen Erdliälfte erfüllen
sollte, während ebenso wahrscheinlich »in de r n äml i c h e n gemässigten
Zone noch zwei b ewo h n t e Er d t e i l e sein k ö n n t e n
oder a u c h mehrere«.') Mit dieser Vermutung griff er offenbar
auf eine Notiz des Pseudo-Aristotelischen Buches: »Von der Welt«
zurück, wo die vermeintliche Existenz noch v i e l e r a n d e r e r Erdinseln
deutlich hervorgehoben war. Aber die Überfahrt nach jenen
Kontinenten schien ilini doch mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden.
Die an Gestalt einem Reitermantel (Chlamys) ähnliche
Oikumene nahm nach seiner Meinung nur ein bescheidenes Stück
Aristot. me t e o r . I I . 5, 13 —1 6 : 0 te ycco Xoyoc ^Eiy.i'VTti' ort Itti nXarog wEi- ujoirrfti,
TO Se y.vy.Xw T\jva:TTEtv h'^E^Ercii Si« Tyi< (ou ^ « j i~EoßaXXEt T« y.a^\j.(nct y.at -0 -d/vy og
yccTcc i^yyog, ett) TT?.(trog, wt t ' Hl' uy 77OV yw?.VEi Bci}.ctTTy;g «rr«!' £ti'«i tto^eI/tiuoi')
ym yaTu Tcc tftati'oan'a tts^i ts Torjg ttJ.oO? yut Tag TiooEiag . . . . K«itc( Itti Tr/.ttToc uei' txE'^ot
-tti' cioiyyj!^T ITUSI' T^i' olyovuLiY!!'- ErSa yao Sia •.l'Cy^og ovyETi y.ctTOVAoZyw, sv^a hs hia Tyu
T« c)E Tyg 'li'8iyy,g e^üj ya\ T'Sli' j-Ty]}.fZi' tüji' 'HoayXEiuii' Sta -y:' Sa}.aTTaf ot> ipalvETKt
crwet^Eti', TiZ Tur'e-^üjc sii'«! Ttarai' Ty^v oiyouaEvvji'.
2) S t r a b o 1, 64 f
' ) \ gl. oben S. 59 u n d Be r g e r , Er a t . S. 87.
•li-ü-S 1 2t i ;4 «'X.y »...'S