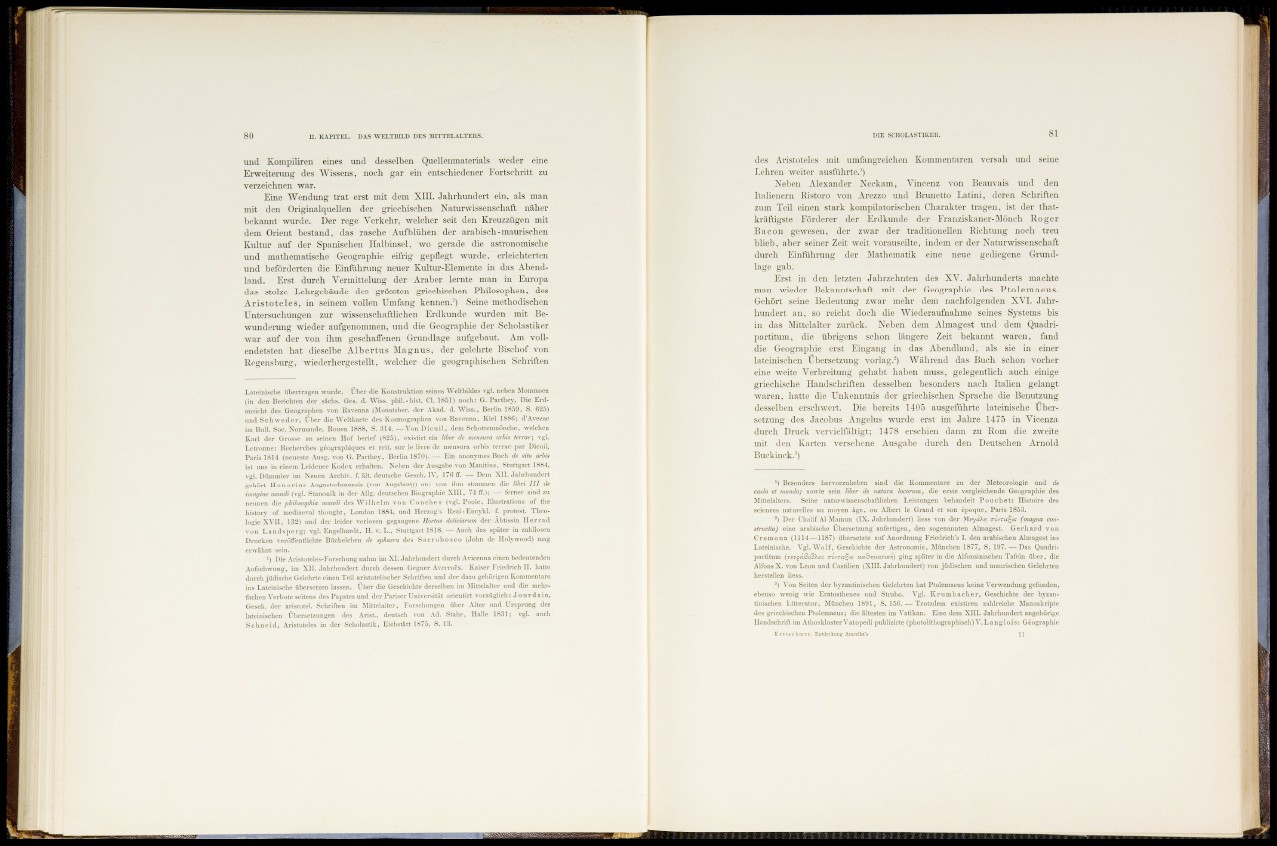
80 n . KAPITEL. DAS WELTBILD DES MITTELALTERS. DIE SCHOLASTIKER. 81
und Kompiiiren eines uiid desselben Quellenmaterials weder eine
Erweiterung des Wissens, noch gar ein entschiedener Fortschritt zu
verzeichnen war.
Eine Wendung trat erst mit dem XIII. Jahrhundert ein, als man
mit den Originalquellen der griechischen Naturwissenschaft näher
bekaimt wurde. Der rege Verkehr, welcher seit den Kreuzzügen mit
dem Orient bestand, das rasche Aufblühen der arabisch-maurischen
Kultur auf der Spanischen Halbinsel, wo gerade die astronomische
und mathematische Geographie eifrig gepflegt wurde, erleichterten
und beförderten die Einführung neuer Kultur-Elemente in das Abendland.
Erst durch Vermittelung der Araber lernte man in Europa
das stolze Lehrgebäude des grössten griechischen Philosophen, des
A r i s t o t e l e s , in seinem vollen Umfang kennen.') Seine methodischen
Untersuchungen zur wissenschaftlichen Erdkunde wurden mit Bewunderung
wieder aufgenommen, und die Geographie der Scholastiker
war auf der von ihm geschaffenen Grundlage aufgebaut. xYm vollendetsten
hat dieselbe Al b e r t u s Ma g n u s , der gelehrte Bischof von
Regensburg, wiederhergestellt, welcher die geogi-aphischen Schriften
Lareinisclie übertr.igen wurde . Übe r die Kons t rukt ion seines "Weltbildes vgl. neben Mommsen
(in den Berichten der siichs. Ges. d. Wi s s . phil.-hist . Cl. 1851) noch: G. Pai-they, Die Erd-
•ansicht des Geogr aphen von Ravenna p l o n a t s b e r . der .-^kad. d. Wi s s . , Berlin 1859, S. 625)
und S c h w e d e r . Über die We l t k a r t e des Ko.smographen von Uavenna, Kiel 1886; d'Avezac
im Bull. Soc. Normande . Rouen 1888, S. 314. — Von D i c u i l , dem Schot tenmöncbe. welchen
Karl der Grosse an seinen Hof berief (825), existirt ein Uber de rnenmra Orbis terrae-, vgl.
l.etronne: Recherches géographiques et crit, Sur le livre de mensiu-a orbis terrae ])ar Dicuil.
Paris 1814 (neueste Ausg. von G. Pa r t h e y . Berlin 1870). — Ein anonymes Buch de situ Orbis
ist uns in einem Leidener Kodex erhalten. Nelien der Ausgabe von Manitius, Stuttgart 1884,
vgl. Diinuuler im Neuen Archiv, f. ält. deutsche Gesch. H' . 176 11'. — Dem XH. . lahrhunder t
gehört H o n o r i u s .'Vugustodunensis (von .Augsburg) an; von ihm stammen die libri III de
imagine mundi (vgl. Stanonik in der Allg. deutschen Biogi-aphie XHI , 74 ft'.): ferner sind zu
nennen iWs philosophia mundi des W i l h e l m v o n C o n c h e s (vgl. Pool e , Illustrations of the
history of mediaeval t h o u g h t , London 1884. und Her zog's Real - Encykl. f, protest. Theolog
ie X"\'II. 132) und dei- leider verloren gegangene Ilortus deliciarum der Äbtissin H e r r a d
von L a n d s p e r g ; vgl. Enge lha rdt , H. v, L.. Stuttgart 1818. — -Auch das späte r in zahllosen
Drucken verötl'entlichte Büchelchen de sphaera des S a c r o b o s c o (John de Holywood) mag
erwähnt sein.
>) Die Aristoteles-Forschung nahm im XL . lahrhunder t durch .Avicenna einen bedeutenden
.Aufschwung, im XII. J a h r h u n d e r t dtu'ch dessen Gegner .Averroi^s. Kaiser Friedrich II. hatte
durch jüdi s che Gelehrte einen Teil aristotelischer Schriften und der dazu gehörigen Konunent a r e
ins Lateinische übersetzen lassen. Übe r die Geschichte derselben im Mittelalter und die mehr -
fachen Verbote seitens des Papstes und der Pari.ser Universität orientirt vorzüglich: J o u r d a i n ,
Gesch. der aristotel. Schriften im Mittelalter, For s chungen über .Alter und Ur s p r u n g der
lateinischen Übersetzungen des Arist., deutsch von Ad. St ahr , Halle 1831; vgl. auch
S c h n e i d , Aristoteles in der Scholastik, Eichstätt 1875, S. 13.
des Aristoteles mit umfangreichen Kommentaren versah und seine
Lehren weiter ausführte.')
Neben Alexander Neckam, Vincenz von Beauvais und den
Italienern Ristoro von Arezzo und Brunetto Latini, deren Schriften
zum Teil einen stark kompilatorisehen Charakter tragen, ist der thatkräftigste
Förderer der Erdkunde der Franziskaner-Mönch Ro g e r
Bacon gewesen, der zwar der traditionellen Richtung noch treu
blieb, aber seiner Zeit weit vorauseilte, indem er der Naturwissenschaft
durch Einführung der Mathematik eine neue gediegene Grundlage
gab.
Erst in den letzten Jahrzehnten des XV. Jahrhunderts machte
man wieder Bekanntschaft mit der Geogi'aphie des P t o l ema e u s .
Gehört seine Bedeutung zwar mehr dem nachfolgenden XVI. Jahrhundert
an, so reicht doch die Wiederaufnahme seines Systems bis
in das Mittelalter zurück. Neben dem Almagest und dem Quadripartitum,
die übrigens schon längere Zeit bekannt waren, fand
die Geographie erst Eingang in das Abendland, als sie in einer
lateinischen Übersetzung vorlag.") Während das Buch schon vorher
eine weite Verbreitung gehabt haben muss, gelegentlich auch einige
griechische Handschriften desselben besonders nach Italien gelangt
waren, hatte die Unkenntnis der griechischen Sprache die Benutzung
desselben erschwert. Die bereits 1405 ausgeführte lateinische Ubersetzung
des Jacobus Angelus wurde erst im Jahre 1475 in Vicenza
durch Druck ver-^ielfältigt; 1478 erschien dann zu Rom die zweite
mit den Karten versehene Ausgabe durch den Deutschen Arnold
Buckinck.')
Besonders hervor zuheben sind die Komme n t a r e zu der Meteorologie un d de
caelo et mujido; sowie sein Iiber de natura locorurriy die erste vergleichende Geograpliie des
Jlittelalters. Seine naturwissenscliai'tlichen Leistungen behandelt P o u c h e t: Histoire des
sciences naturelles au moyen âge . ou Albert le Grand et son é p o q u e , Pa r i s 1853.
Der Chalif AI Mamun (IX. J a h r h u n d e r t ) liess von der M£7fc^v] a-ivTct^iç (magna constructio)
eine arabische Übe r s e t zung anf er t igen, den sogenannten Almagest. G e r h a r d v o n
C r e m o n a (1114—1187) iäbersetzte auf Anordnung Fr i edr i ch' s L den arabischen Alma g e s t i n s
Lateinische. Vgl. "Wolf, Geschichte der As t ronomi e, München 1877, S. 197. — Das Quadripartitum
(T£rp«/3t,ÔXoç un^Yi'xccTMi}) ging später in die Alfonsinischen Tafeln ü b e r , die
Alfons X. von Leon und Castilien (XI IL J a h r h u n d e r t ) von jüdi s chen und maurischen Gelehrten
herstellen liess.
Von Seiten der byzantinischen Gelehrten hat Ptolemaeus keine Ve rwe n d u n g gefunden,
ebenso wenig wie Er a tos thenes und Strabo. Vgl. K r u m b a c h e r , Geschichte de r byzantinischen
Li t t e r a tur , München 1891, S. 156. — Trot zdem existiren zahh-eiche Manuskr ipt e
des griechischen Ptol ema eus; die ältesten im Vatikan. Eine dem XI IL J a h r h u n d e r t angehürige
Handschrift im Athosklos t e rVa topedi pubhz i r t e (photolithographisch) V . L a n g l o i s : Géogr aphie
K re tsc il mer. Entdeckung .^iiierika's H