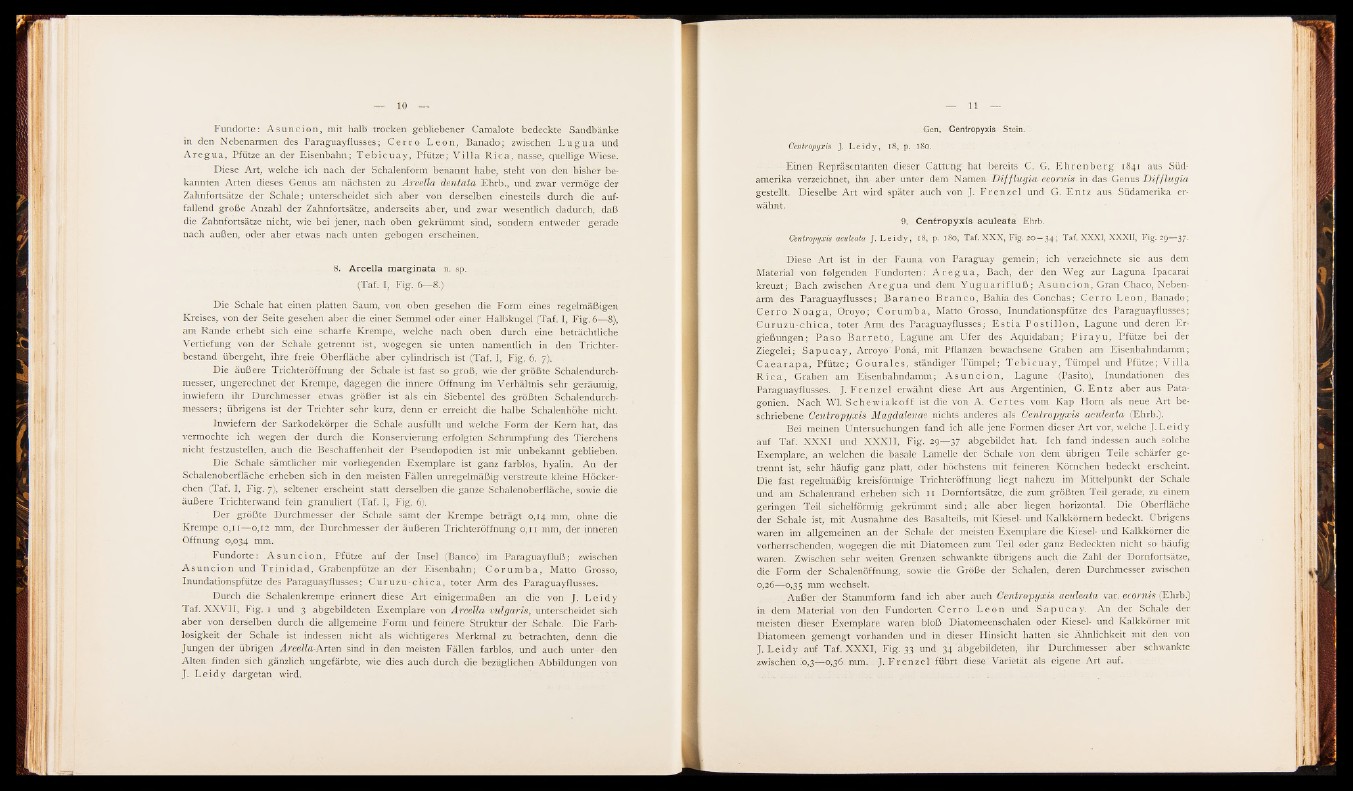
Fundorte: A s u n c i o n , mit halb trocken gebliebener Camalote bedeckte Sandbänke
in den Nebenarmen des Paraguayflussesj C e r r o L e o n , Banado; zwischen L u g u a und
A r e g u a , Pfütze an der Eisenbahn; T e b i c u a y , Pfütze; V i l l a R i c a , nässe, quellige Wiese.
Diese A r t, welche ich nach der Schalenform benannt habe, steht von den bisher bekannten
Arten dieses Genus am nächsten zu Arcella dentata Ehrb., und zwar vermöge der
Zahnfortsätze der S ch a le ; unterscheidet sich aber von derselben einesteils durch die auffallend
g ro ß e Anzahl der Zahnfortsätze, anderseits aber, und zwar wesentlich dadurch, daß
die Zahnfortsätze nicht, wie bei jener, nach oben gekrümmt sind, sondern entweder gerade
nach außen, oder aber etwas nach unten gebo gen erscheinen.
8. A rc e lla m a rg in a ta n. sp.
(Taf. I, F ig. 6— 8|nvv
Die Schale hat einen platten Saum, von oben gesehen die Form eines regelmäßigen
Kreises, von der Seite gesehen aber die einer Semmel oder einer Halbkugel (Taf. I, F ig. 6— 8),
am Rande erhebt sich eine scharfe Krempe, welche nach oben durch eine beträchtliche
Vertiefung von der Schale getrennt ist, wogegen sie unten namentlich in den Trichter-
beständ übergeht, ihre freie Oberfläche aber cylindrisch ist (Taf. I, Fig.! 6. 7)... .
D ie äußere Trichteröffnung der Schale ist fast so g roß, wie der g rö ß te Schalendurchmesser,
ungerechnet der Krempe, dagegen die innere Öffnung im Verhältnis sehr geräumig,
inwiefern ihr Durchmesser etwas größer ist als ein Siebentel des größten Schalendurchmessers;
übrigens ist der Trichter sehr kurz, denn er erreicht die halbe Schalenhöhe nicht.
Inwiefern der Sarkodekörper die Schale ausfüllt und welche Form der Kern hat, das
vermochte ich wegen der durch die Konservierung erfolgten Schrumpfung des Tierchens
nicht festzustellen, auch die Beschaffenheit der Pseudopodien ist mir unbekannt geblieben.
D ie Schale sämtlicher mir vorliegenden Exemplare ist ganz farblos, hyalin. A n der
Schalenoberfläche' erheben sich in den meisten Fällen unregelmäßig verstreute kleine Höcker-
chen (Taf. I, F ig. 7), seltener erscheint statt derselben die ganze Schalenoberfläche, sowie die
äußere Trichterwand fein granuliert (Taf. I, F ig. 6).
D er grö ß te Durchmesser der Schale samt der Krempe beträgt 0,14 mm, ohne die
Krempe 0,11— 0,12 mm, der Durchmesser der äußeren Trichteröffnung 0,11 mm, der inneren
Öffnung 0,034 mm.
Fundorte: A s u n c i o n , Pfütze auf der Insel (Banco) im Pa ragua y fluß; zwischen
A s u n c i o n und T r i n i d a d , Grabenpfütze an der Eisenbahn; G o r u m b a , Matto Grosso,
Inundationspfütze dqs Paraguayflusses; C u r u z u - c h i c a , toter Arm des Paraguayflusses.
Durch die Schalenkrempe erinnert diese A r t einigermaßen an die von J. L e i d y
T a f. X X V I I , Fig. 1 und 3 abgebildeten Exemplare von Arcella vulgaris, unterscheidet sich
aber von derselben durch die allgemeine Form und feinere Struktur der Schale. Die F arb losigkeit
der Schale ist indessen nicht als wichtigeres Merkmal zu betrachten, denn die
Jungen der übrigen Arcella-Arten sind in den meisten Fällen farblos, und auch unter den
A lten finden sich gänzlich ungefärbte, wie dies auch durch die bezüglichen Abbildungen von
J. L e i d y dargetan wird.
. Gen. Centropyxis Stein. .
Centropyxis J. L e id y , 18, p. 180.
Einen Repräsentanten dieser Gattung hat bereits C. G. E h r e n b e r g 1841 aus Südamerika
verzeichnetj ihn aber unter dem Namen D ifflu g ia ecornis in das Genus D ifflug ia
gestellt. Dieselbe A r t wird später auch von J. F r e n z e l und G. E n t z aus Südamerika erwähnt.
9. C en tro p y x is a cu le a ta Ehrb.
Centropyxis aculeata J. L e id y , 18, p. 180, Taf. XXX, Fig. 20—34; Taf. XXXI, XXXII, Fig. 29— 37.
Diese A r t ist in der Fauna von Paraguay gemein; ich verzeichnete sie aus dem
Material von folgenden Fundor ten: A r e g u a , Bach, dér den W e g zur Laguna Ipacarai
kreuzt; Ba ch zwischen A r e g u a und dem Y u g u a r i f l ü ß ; A s u n c i o n , Grän Chaco, Nebenarm
des Paraguayflusses; B a r a n e o B r a n c o , Bahia des Conchas; C e r r o 'L e o n , Banado;
C e r r o .N o a g a , Oroyo; G o r u m b a , Matto Grosso, Inundationspfütze des Paraguayflusses;
C u r u z ü - c h i c a , toter Arm des Paraguayflusses; É s t i a P o s t i l i o n , Lagune und deren E r g
ießun gen ; ' P a s o B a f r e t o , Lagune am U fe r des Aqüidäban; P i r a y u , Pfütze bei der
Z ie g e le i;. S a p u c a y , Arro yo Poná, mit Pflanzen bewachsene Graben am Eisenbahndamm;
C a e a r a p a , Pfütze; G o u r a l e s , ständiger Tümpel; T e b i c u a y , Tümpel und Pfütze; V i l l a
R.iic.a, Graben am Eisenbahndamm; A s u n c i o n , Lagune (Pasito), Inundationen des
Paraguayflusses. J. F r e n z e l erwähnt diese A r t aus Argentinien, G. E n t z aber aus Patagonien.
Nach W l. S c h e w i a k o f f ist die von A . C e r t é s vom Kap Horn als neue A r t beschriebene
Centropyxis Magdalenas nichts anderes als Centropyxis aculeata (Ehrb.).
Be i meinen Untersuchungen fand ich alle jene Formen dieser A r t vor, welche J. L e i d y
auf T a f. X X X I und X X X I I , Fig. I f—37 abgebildet hat. Ich fand indessen auch solche
Exemplare, an welchen die basale Lamelle der Schale von dem übrigen Teile schärfer ge trennt
ist, sehr häufig ganz platt, öder höchstens mit feineren Körnchen bedeckt erscheint.
Die fast regelmäßig kreisförmige Trichteröffnung liegt nahezu im Mittelpunkt der Schale
und am Schalenrand erheben sich n Dornfortsätze, die zum größten T e il gerade, zu einem
geringen T e il sichelförmig gekrümmt sind; alle aber liegen horizontal. Die Oberfläche
der Schale ist, mit Ausnahme des Basalteils, mit Kiesel- und Kalkkörnern bedeckt. Übrigens
waren im* allgemeinen an der Schale! der meisten Exemplare die Kiesel- und Kalkkörner die
vorherrschenden, wogegen die mit Diatomeen zum T e il oder ganz Bedeckten nicht so häufig
waren. Zwischen sehr weiten Grenzen schwankte übrigens auch die Zahl der Dornfortsätze,
die Form der Schalenöffnung, sowie die Größe der Schalen, deren Durchmesser zwischen
0,26-^-70,35 mm wechselt.
A u ß e r ’ der Stammform fand ich aber auch Centropyxis aculeata var. ecornis (Ehrb.)
in dem Material von den Fundorten C e r r o p | e o n und S a p u c a y . A n der Schale der
meisten dieser Exemplare waren i:i|lq ß Diatomeenschalen oder Kiesel- und Kalkkörner mit
Diatomeen gemengt vorhanden und in dieser Plinsicht h a tten . sie Ähnlichkeit mit den von
J. L e i d y auf T a f. X X X I , F ig. 33 und 34 ’abgebildeten, ihr Durchmesser aber schwankte
zwischen b ,3— 0,36. mm. J .v F r e n z e l führt diese Varietät, als eigene. A r t auf.