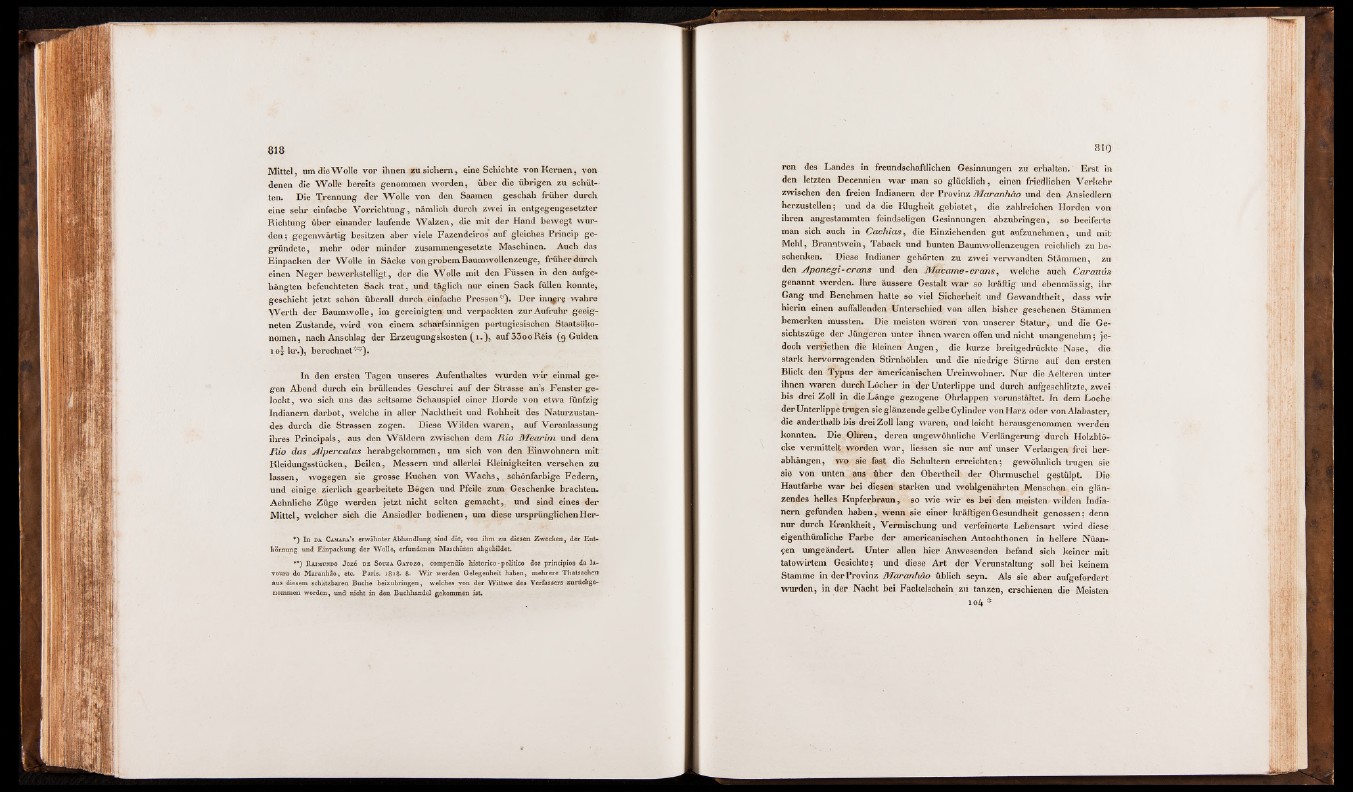
Mittel, um die Wolle vor ihnen zu sichern, eine Schichte von Kernen, von
denen die Wolle bereits genommen worden, über die übrigen zu schütten.
Die Trennung der Wolle von den Saämen geschah früher durch
eine sehr einfache Vorrichtung, nämlich durch zwei in entgegengesetzter
Richtung über einander laufende Walzen, die mit der Hand bewegt wurden;
gegenwärtig besitzen aber viele Fazendeiros auf gleiches Princip gegründete,
mehr oder minder zusammengesetzte, Maschinen. Auch das
Einpacken der Wolle in Säcke von grobem Baumwollenzeuge, früher durch
einen Neger bewerkstelligt, der die Wolle mit den Füssen in den aufgehängten
befeuchteten Sack trat, und täglich nur einen Sack füllen konnte,
geschieht jetzt schon überall durch einfache Pressen *). Der inr^r§ wahre
W e r th der Baumwolle, im gereinigten und verpackten zur Aufruhr geeigneten
Zustande, wird von einem scharfsinnigen portugiesischen Staatsökonomen,
nach Anschlag der Erzeugungskosten ( 1 .) , auf 33 oo Reis (9 Gulden
1 o ! kr.), berechnet**).
In den ersten Tagen unseres Aufenthaltes wurden w ir einmal gegen
Abend durch ein brüllendes. Geschrei auf der Strasse- an’s Fenster gelockt,
wo sich uns das seltsame Schauspiel einer Horde von etwa fünfzig
Indianern darbot, welche in aller Nacktheit und Rohheit des Naturzustandes
durch die Strassen zogen. Diese Wilden waren, auf Veranlassung
ihres Principals, aus den Wäldern zwischen dem Rio JMearim und dem
Rio das Alperccdas herabgekommen, um sich von den Einwohnern mit
Kleidungsstücken, Beilen, Messern und allerlei Kleinigkeiten versehen zu
lassen, wogegen sie grosse Kuchen von W a c h s ,; schönfarbige Federn,
und einige zierlich gearbeitete Bögen und Pfeile zum Geschenke brachten.
Aehnliche Züge werden jetzt nicht selten gemacht, und sind eines der
Mittel, welcher sich die Ansiedler bedienen, um diese ursprünglichenHer-
*) In da Camara’s erwähnter Abhandlung sind die, von ihm zu diesen Zwecken, der Enthornung
und Einpackung der Wolle, erfundenen Maschinen abgebildet.
*’ ) Raimundo Joze de Souza Gayozo, compendio historico-politico dos principios da Ia-
voüra do Maranhao, etc. Paris. 1818- 8* Wir werden Gelegenheit haben, mehrere Thatsachen
aus diesem schätzbaren Buche beizubringen, welches von der Wittwe des Verfassers zurückgenommen
worden, und nicht in den Buchhandel gekommen ist.
ren des Landes in freundschaftlichen Gesinnungen zu erhalten. Erst in
den letzten Decennien war man so glücklich, einen friedlichen Verkehr
zwischen den freien Indianern der Provinz IMaranhäo und den Ansiedlern
herzustellen; und da die Klugheit gebietet, die zahlreichen Hörden von
ihren angestammten feindseligen Gesinnungen abzubringen, so beeiferte
man sich auch in Cachias, die Einziehenden gut aufzunehmen, und mit
Mehl, Branntwein, Taback und bunten Baumwollenzeugen reichlich zu beschenken.
Diese Indianer gehörten zu zwei verwandten Stämmen, zu
den Aponegi- er ans und den Mäcame - er ans, welche auch Carauüs
genannt werden. Ihre äussere Gestalt war so kräftig und ebenmässig, ihr
Gang und Benehmen hatte so viel Sicherheit und Gewandtheit, dass w ir
hierin einen auffallenden Unterschied von allen bisher gesehenen Stämmen
bemerken mussten. Die meisten wären von unserer Statur, und die Gesichtszüge
der Jüngeren unter ihnen waren offen und nicht unangenehm; jedoch
verriethen die kleinen' Augen, die kurze breitgedrückte ■ Nase, die
stark hervorragenden Stirnhöhlen und die niedrige Stirne auf den ersten
Blick den Typus der americanischen Ureinwohner. Nur die Aelteren unter
ihnen waren durch Löcher in der Unterlippe und durch aufgeschlitzte, zwei
bis drei Zoll in die Länge gezogene Ohrlappen verunstältet. In dem Loche
der Unterlippe trugen sie glänzende gelbe Cylinder von Harz oder von Alabaster,
die anderthalb bis drei Zoll lang waren, und leicht herausgenommen werden
konnten. Die Ohren, deren ungewöhnliche Verlängerung durch Holzblöcke
vermittelt worden wa r , Hessen sie nur auf unser Verlangen frei herabhängen,
wo sie fast die Schultern erreichten; gewöhnlich trugen sie
sie von unten aus über den Obertheil der Ohrmuschel gestülpt. Die
Hautfarbe war bei diesen starken und wohlgenährten Menschen ein glänzendes
helles Kupferbraun, so wie w ir es bei den meisten? wilden Indianern
gefunden haben, wenn sie einer kräftigen Gesundheit genossen; denn
nur durch Krankheit, Vermischung und verfeinerte Lebensart wird diese
eigenthümliche Farbe der americanischen Autochthonen in hellere Nüan-
$en umgeändert. Unter allen hier Anwesenden befand sich keiner mit
tatowirtem Gesichte; und diese Art der Verunstaltung soll bei keinem
Stamme in der Provinz Maranhao üblich seyn. Als sie aber aufgefordert
wurden, in der Nacht bei Fackelschein zu tanzen, erschienen die Meisten