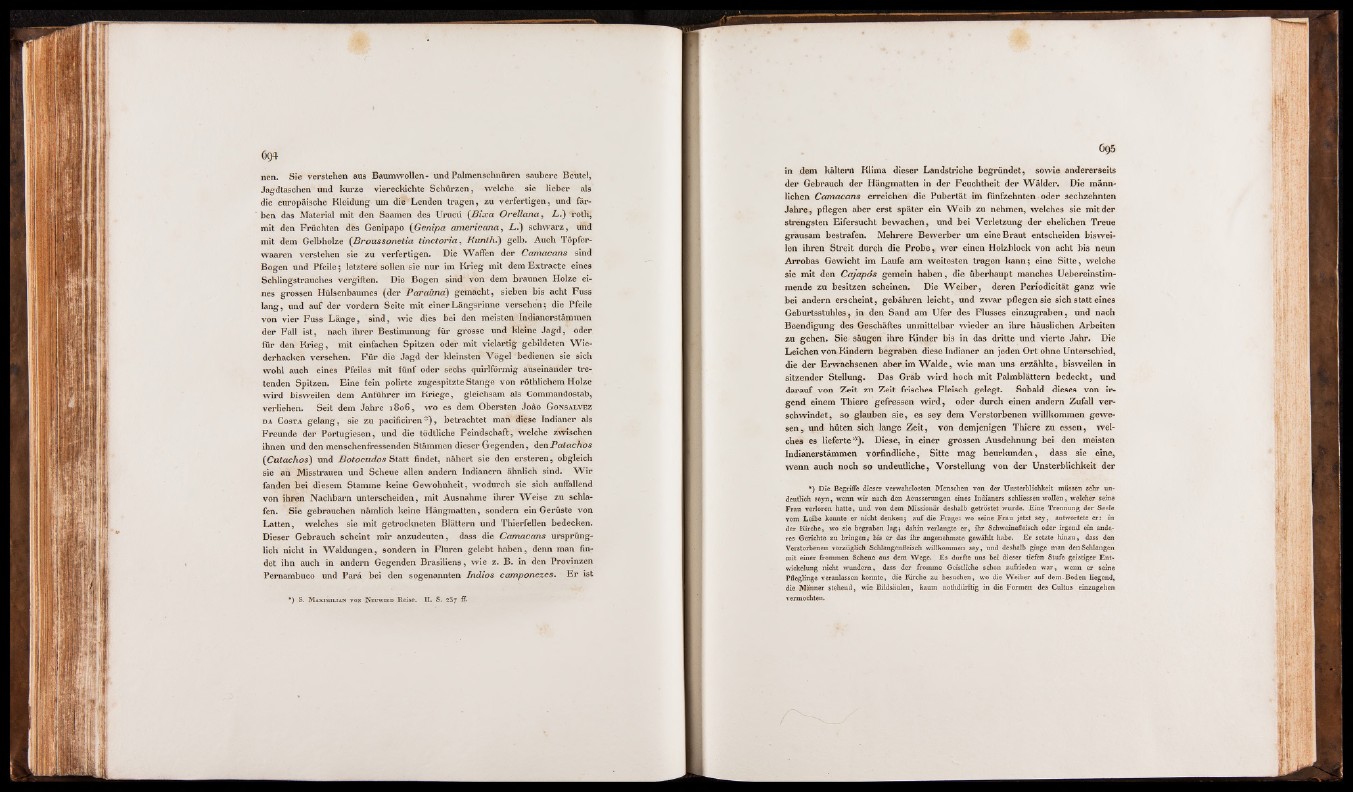
ÖQ4
nen. Sie verstehen aus Baumwollen- und Palmenschnüren saubere Beutel,
Jagdtaschen und kurze viereckichte Schürzen, welche sie lieber als
die europäische Kleidung um dié Lenden tragen, zu verfertigen, und färben
das Material mit den Saamen des Urucü (JBixa Orellana, L .) roth,
mit den Früchten des Genipapo (Genipa americana, L .) schwarz, und
mit dem Gelbholze (Broussonetia tinctoria, Kunthï) gelb. Auch Töpfer-
waaren verstehen sie zu verfertigen. Die Waffen der Camacans sind
Bogen und Pfeile 5 letztere sollen sie nur im Krieg mit dem Extracte eines
Schlingstrauches vergiften. Die Bogen sind' von dem braunen Holze eines
grossen Hülsenbaumes (der Paraüna) gemacht, sieben bis acht Fuss
lang, und auf der vordem Seite mit einer Längsrinne versehen; die Pfeile
von vier Fuss Länge, sind, wie dies bei den meisten Indianerstämmen
der Fall ist, nach ihrer Bestimmung für grosse und kleine Jagd, oder
für den Krieg, mit einfachen Spitzen oder mit vielartig gebildeten W iederhacken
versehen. Für die Jagd der kleinsten Vögel bedienen sie sich
wohl auch eines Pfeiles mit fünf oder sechs quirlförmig auseinander tretenden
Spitzen. Eine fein polirte zugespitzte Stange von röthlichem Holze
wird bisweilen dem Anführer im Kriege, gleichsam als Commandostab,
verliehen. Seit dem Jahre 1806, wo es dem Oberöten Joäo G o nsa lve z
d a C o sta gelang, sie zu pacificiren* ) , betrachtet man diese Indianer als
Freunde der Portugiesen, und die tödtliche Feindschaft, welche zwischen
ihnen und den menschenfressenden Stämmen dieser Gegenden, den Patachos
(Cutachos) und Botocudos Statt findet, nähert sie den ersteren, obgleich
sie an Misstrauen und Scheue allen andern Indianern ähnlich sind. W ir
fanden bei diesem Stamme keine Gewohnheit, wodurch sie sich auffallend
von ihren Nachbarn unterscheiden, mit Ausnahme ihrer Weise zu schlafen.
Sie gebrauchen nämlich keine Hängmatten, sondern ein Gerüste von
Latten, welches sie mit getrockneten Blättern und Thierfellen bedecken.
Dieser Gebrauch scheint mir anzudeuten, dass die Camacans ursprünglich
nicht in Waldungen, sondern in Fluren gelebt haben, denn man findet
ihn auch in andern Gegenden Brasiliens, wie z. B. in den Provinzen
Pemambuco und Para bei den sogenannten Indios camponezes. E r ist
*) S. Maximilian ton Neuwied Reise. II. S. 237 ff
in dem kältern Klima dieser Landstriche begründet, sowie andererseits
der Gebrauch der Hängmatten in der Feuchtheit der Wälder. Die männlichen
Camacans erreichen die Pubertät im fünfzehnten oder sechzehnten
Jahre, pflegen aber erst später ein Weib zu nehmen, welches sie mit der
strengsten Eifersucht bewachen, und bei Verletzung der ehelichen Treue
grausam bestrafen. Mehrere Bewerber um eine Braut entscheiden bisweilen
ihren Streit durch die Probe, w er einen Holzblock von acht bis neun
Arrobas Gewicht im Laufe am weitesten tragen kann; eine Sitte, welche
sie mit den Cajapös gemein haben, die überhaupt manches Uebereinstim-
mende zu besitzen scheinen. Die Weiber , deren Periodicität ganz wie
bei andern erscheint, gebähren leicht, und zwar pflegen sie sich statt eines
Geburtsstuhles, in den Sand am Ufer des Flusses einzugraben, und nach
Beendigung des Geschäftes unmittelbar wieder an ihre häuslichen Arbeiten
zu gehen. Sie säugen ihre Kinder bis in das dritte und vierte Jahr. Die
Leichen von Kindern begraben diese Indianer an jeden Ort ohne Unterschied,
die der Erwachsenen aber im Wa ld e , wie man uns erzählte, bisweilen in
sitzender Stellung. Das Grab wird hoch mit Palmblättern bedeckt, und
darauf von Zeit zu Zeit frisches Fleisch gelegt. Sobald dieses von irgend
einem Thiere gefressen wird , oder durch einen andern Zufall verschwindet,
so glauben sie, es sey dem Verstorbenen willkommen gewesen,
und hüten sich lange Zeit, von demjenigen Thiere zu essen, welches
es lieferte*)» Diese, in einer grossen Ausdehnung bei den meisten
Indianerstämmen vorfindliche, Sitte mag beurkunden, dass sie eine,
wenn auch noch so undeutliche, Vorstellung von der Unsterblichkeit der
*) Die Begriffe dieser verwahrlosten Menschen von der Unsterblichkeit müssen sehr undeutlich
seyn, wenn wir nach den Aeusserungen eines Indianers schliessen wollen, welcher seine
Frau verloren hatte, und von dem Missionär deshalb getröstet wurde. Eine Trennung der Seele
vom Leibe konnte er nicht denken; auf die Frage: wo seine Frau jetzt sey, antwortete er: in
der Kirche, wo sie begraben lag; dahin verlangte er, ihr Schweinefleisch oder irgend ein anderes
Gerichte zu bringen,* bis er das ihr angenehmste gewählt habe. Er setzte hinzu, dass den
Verstorbenen vorzüglich Schlangenfleisch willkommen sey, und deshalb ginge man den Schlangen
mit einer frommen Scheue aus dem Wege. Es durfte uns bei dieser tiefen Stufe geistiger Entwickelung
nicht wundem, dass der fromme Geistliche schon zufrieden war, wenn er seine
Pfleglinge veranlassen konnte, die Kirche zu besuchen, wo die Weiber auf dem.Boden liegend,
die Männer stehend, wie Bildsäulen, kaum nothdürftig in die Formen des Cultus einzugehen
vermochten.