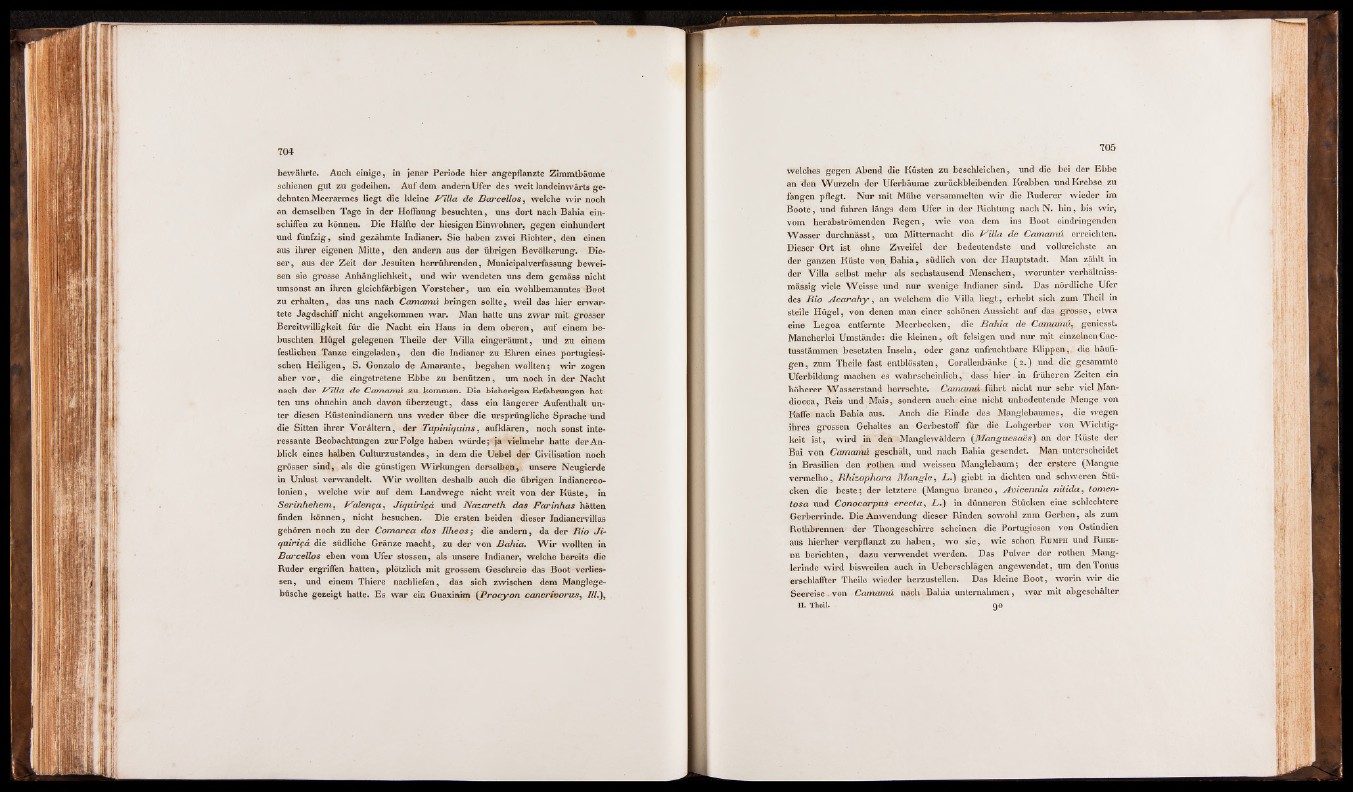
bewährte. Auch einige, in jener Periode hier angepflanzte Zimmtbäume
schienen gut zu gedeihen. Auf dem andernUfer des weit landeinwärts gedehnten
Meerarmes liegt die kleine F illa de Barcellos, welche w ir noch
an demselben Tage in der Hoffnung besuchten, uns dort nach Bahia ein-
schiffen zu können. Die Hälfte der hiesigen Einwohner, gegen einhundert
und fünfzig, sind gezähmte Indianer. Sie haben zwei Richter, den einen
aus ihrer eigenen Mitte, den andern aus der übrigen Bevölkerung. Diese
r , aus der Zeit der Jesuiten herrührenden, Municipalverfassung beweisen
sie grosse Anhänglichkeit, und w ir wendeten uns dem gemäss nicht
umsonst an ihren gleichfarbigen Vorsteher, um ein wohlbemanntes Boot
zu erhalten, das uns nach Camamu bringen sollte, weil das hier erwartete
Jagdschiff nicht angekommen war. Man hatte uns zwar mit grosser
Bereitwilligkeit für die Nacht ein Haus in dem oberen, auf einem bebuschten
Hügel gelegenen Theile der Villa eingeräumt, und zu einem
festlichen Tanze eingeladen, den die Indianer zu Ehren eines portugiesischen
Heiligen, ,S. Gonzalo de Amarante, begehen wollten; w ir zogen
aber vor, die eingetretene Ebbe zu benützen, um noch in der Nacht
nach der F illa de Camamu zu kommen. Die bisherigen Erfahrungen hatten
uns ohnehin auch davon überzeugt, dass ein längerer Aufenthalt unter
diesen Küstenindianem uns weder über die ursprüngliche Sprache und
die Sitten ihrer Vorältem, der Tupiniquins, aufklären, noch sonst interessante
Beobachtungen zur Folge haben würde;: ja vielmehr hatte der Anblick
eines halben Culturzustandes, in dem die Uebel der Civilisation noch
grösser sind, als die günstigen Wirkungen derselben, unsere Neugierde
in Unlust verwandelt. W i r wollten deshalb auch die übrigen Indianerco-
lonien, welche w ir auf dem Landwege nicht weit von der Küste, in
Serinhehem, Falenga, Jiquirigä und Nazareth das Farinhas hätten
finden können, nicht besuchen. Die ersten beiden dieser Indianervillas
gehören noch zu der Comarca dos Ilheos; die andern, da der Rio Jiquirigä
die südliche Gränze macht, zu der von Bahia. W i r wollten in
Barcellos eben vom Ufer stossen, als unsere Indianer, welche bereits die
Ruder ergriffen hatten, plötzlich mit grossem Geschreie das Boot verlies-
sen, und einem Thiere nachliefen, das sich zwischen dem Manglege-
büsche gezeigt hatte. Es war ein Guaxinim (Procyon cancrivorus, ///.),
welches gegen Abend die Küsten zu beschleichen, und die bei der Ebbe
an den Wurzeln der Uferbäume zurückbleibenden Krabben und Krebse zu
fangen pflegt. Nur mit Mühe versammelten w ir die Ruderer wieder im
Boote, und fuhren längs dem Ufer in der Richtung nach N. hin, bis wir,
vom herabströmenden Regen, wie von dem ins Boot eindringenden
Wasser durchnässt, um Mitternacht die F illa de Camamu erreichten.
Dieser Ort ist ohne Zweifel der bedeutendste und volkreichste an
der ganzen Küste von Bahia, südlich von der Hauptstadt. Man zahlt in
der Villa selbst mehr als sechstausend Menschen, worunter verhältniss-
mässig viele Weisse imd nur wenige Indianer sind. Das nördliche Ufer
des Rio A ca rd h y , an welchem die Villa liegt, erhebt sich zum Theil in
steile Hügel, von denen man einer schönen Aussicht auf das grosse, etwa
eine Legoa entfernte Meerbecken, die Bahia de Camamuy geniesst.
Mancherlei Umstände: die kleinen, oft felsigen und nur mit einzelnenCac-
tusstämmen besetzten Inseln, oder ganz unfruchtbare Klippen,^: die* häufigen,
zum Theile fast entblössten, Corallenbänke (2 .) und die gesammte
Uferbildung machen es wahrscheinlich,' dass hier in früheren Zeiten ein
höherer Wasserstand herrschte. Camamu führt nicht nur sehr viel Man-
diocca, Reis und Mais, sondern auch-eine nicht unbedeutende Menge von
Kaffe nach Bahia aus. Auch die Rinde des Manglebaumes, die wegen
ihres grossen Gehaltes an Gerbestoff für die Lohgerber von Wichtigkeit
ist, wird in den"'Manglewäldern (Manguesaes) an der Küste der
Bai von Camamu geschält, und nach Bahia gesendet. Man unterscheidet
in Brasilien den rothen und weissen Manglebaum; der erstere (Mangue
vermelho, Rhizophora Mangle, L i) giebt in dichten und schweren Stücken
die beste; der letztere (Mangue branco, Avicennia nitida, tomen-
tosa und Conocarpus erecta, L i) in dünneren Stücken eine schlechtere
Gerberrinde. Die Anwendung dieser Rinden sowohl zum Gerben, als. zum
Rothbrennen1 der Thongeschirre scheinen die Portugiesen von Ostindien
aus hierher verpflanzt zu haben, wo sie, wie schon Ru mph und R hee-
d e berichten, dazu verwendet werden. Das Pulver der rothen Mang-
lerinde wird bisweilen auch in Ueberschlägen angewendet, um den Tonus
erschlaffter Theile wieder herzustellen. Das kleine Boot, worin w ir die
Seereise.von Camamu nach Bahia unternahmen, war mit abgeschälter
II. Theil. 90