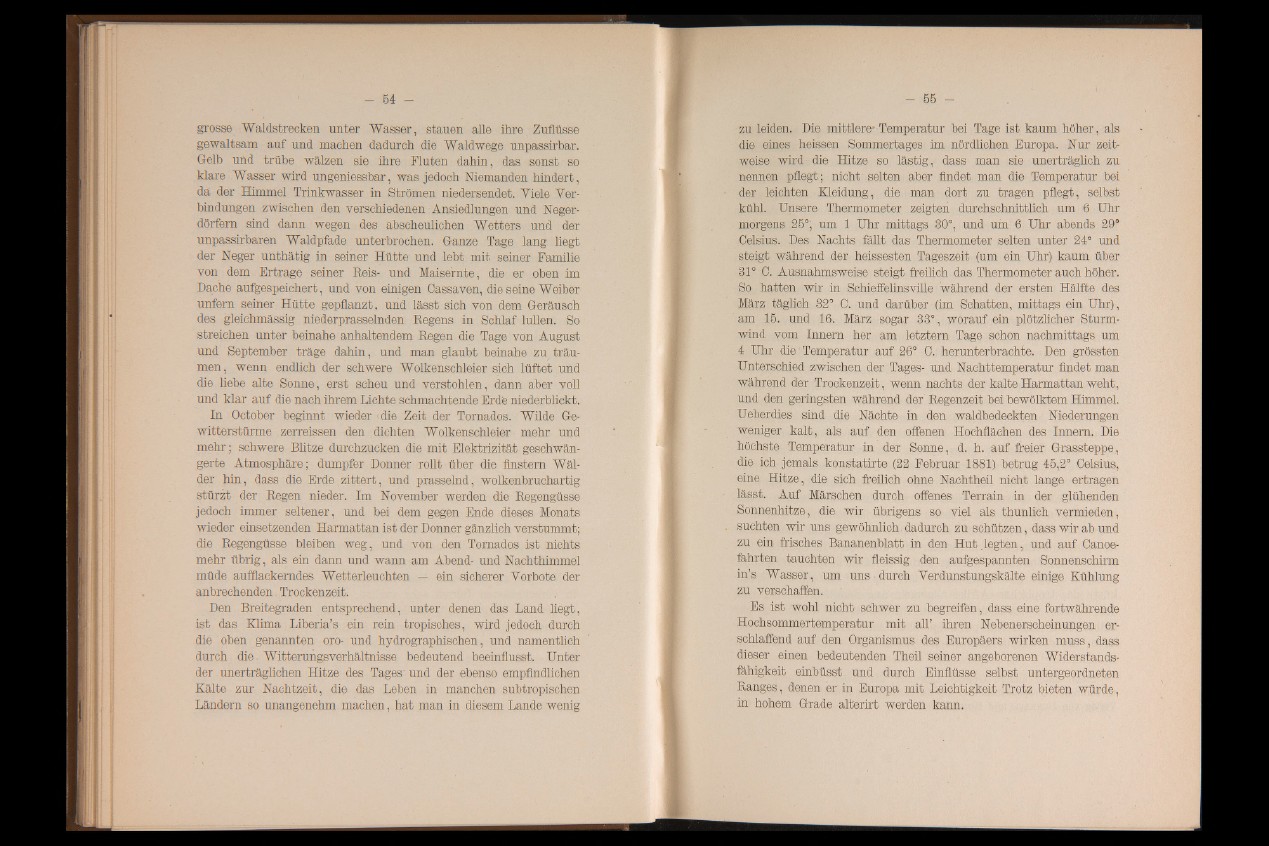
grosse Waldstrecken unter Wasser, stauen alle ihre Zuflüsse
gewaltsam auf und machen dadurch die Waldwege unpassirbar.
Gelb und trübe wälzen sie ihre Fluten dahin, das sonst so
klare Wasser wird ungeniessbar, was jedoch Niemanden hindert,
da der Himmel Trinkwasser in Strömen niedersendet. Viele Verbindungen
zwischen den verschiedenen Ansiedlungen und Negerdörfern
sind dann wegen des abscheulichen Wetters und der
unpassirbaren Waldpfade unterbrochen. Ganze Tage lang liegt
der Neger unthätig in seiner Hütte und lebt mit seiner Familie
von dem Ertrage seiner Reis- und Maisernte, die er oben im
Dache aufgespeichert, und von einigen Gassaven, dieseine Weiber
unfern seiner Hütte gepflanzt, und lässt sich von dem Geräusch
des gleichmässig niederprasselnden Regens in Schlaf lullen. So
streichen unter beinahe anhaltendem Regen die Tage von August
und September träge dahin, und man glaubt beinahe zu träumen,
wenn endlich der schwere Wolkenschleier sich lüftet und
die hebe alte Sonne, erst scheu und verstohlen, dann aber voll
und klar auf die nach ihrem Lichte schmachtende Erde niederblickt.
In October beginnt wieder die Zeit der Tornados. Wilde Gewitterstürme
zerreissen den dichten Wolkenschleier mehr und
mehr; schwere Blitze durchzucken die mit Elektrizität geschwängerte
Atmosphäre; dumpfer Donner rollt über die finstern Wälder
hin, dass die Erde zittert, und prasselnd, wolkenbruchartig
stürzt der Regen nieder. Im November werden die Regengüsse
jedoch immer seltener, und bei dem gegen Ende dieses Monats
wieder einsetzenden Harmattan ist der Donner gänzlich verstummt;
die Regengüsse bleiben weg, und von den Tornados ist nichts
mehr übrig, als ein dann und wann am Abend- und Nachthimmel
müde aufflackerndes Wetterleuchten jp ein sicherer Vorbote der
anbrechenden Trockenzeit.
Den Breitegraden entsprechend, unter denen das Land liegt,
ist das Klima Liberia’s ein rein tropisches, wird jedoch durch
die oben genannten oro- und hydrographischen, und namentlich
durch die Witterungsverhältnisse bedeutend beeinflusst. Unter
der unerträglichen Hitze des Tages' und der ebenso empfindlichen
Kälte zur Nachtzeit, die das Leben in manchen subtropischen
Ländern so unangenehm machen, hat man in diesem Lande wenig
zu leiden. Die mittlere*Temperatur bei Tage ist kaum höher, als
die eines heissen Sommertages im nördlichen Europa. Nur zeitweise
'wird die Hitze so lästig, dass man sie unerträglichzu
nennen pflegt; nicht selten aber findet man die Temperatur bei
der leichten ■ Kleidung, die man dort zu tragen pflegt, selbst
kühl. Unsere Thermometer zeigten durchschnittlich um 6 Uhr
morgens 25°, um 1 Uhr mittags 30°, und um 6 Uhr abends 29°
Celsius. Des Nachts fällt das Thermometer selten unter 24° und
steigt während der heissesten Tageszeit (um ein Uhr) kaum über
31° C. Ausnahmsweise steigt freilich das Thermometer auch höher.
So hatten wir in Schieffelinsville während der ersten Hälfte des
März täglich 32° C. und darüber (im Schatten, mittags ein Uhr),
am 15. und 16. März sogar 33°, worauf ein plötzlicher Sturmwind
vom Innern her am letztem Tage schon nachmittags um
4 Uhr die' Temperatur auf 26° C. herunterbrachte. Den grössten
Unterschied zwischen der Tages- und Nachttemperatur findet man
während der Trockenzeit, wenn nachts der kalte Harmattan weht,
und den geringsten während der Regenzeit bei bewölktem Himmel.
Ueberdies sind die Nächte in den waldbedeckten Niederungen
weniger kalt, als auf den offenen Hochflächen des Innern. Die
höchste Temperatur in der Sonne, d. h. auf freier Grassteppe,
die ich jemals konstatirte (22 Februar 1881) betrug 45,2° Celsius,
eine Hitze, die sich freilich ohne Nachtheil nicht lange ertragen
lässt. Auf Märschen durch offenes Terrain in der glühenden
Sonnenhitze, die wir übrigens so viel als thunlich vermieden,
suchten wir uns gewöhnlich. dadurch zu schützen, dass wir ab und
zu ein frisches Bananenblatt in den Hut.legten, und auf Canoe-
fahrten tauchten wir fleissig den aufgespannten Sonnenschirm
in’s Wasser, um uns ■ durch Verdunstungskälte einige Kühlung
zu verschaffen.
Es ist wohl nicht' schwer zu begreifen, dass eine fortwährende
Hochsommertemperatur mit all’ ihren Nebenerscheinungen erschlaffend
auf den Organismus des Europäers wirken muss, dass
dieser einen bedeutenden Theil seiner angeborenen Widerstandsfähigkeit
einbüsst und durch Einflüsse selbst untergeordneten
Ranges, denen er in Europa mit Leichtigkeit Trotz bieten würde,
in hohem Grade alterirt werden kann.