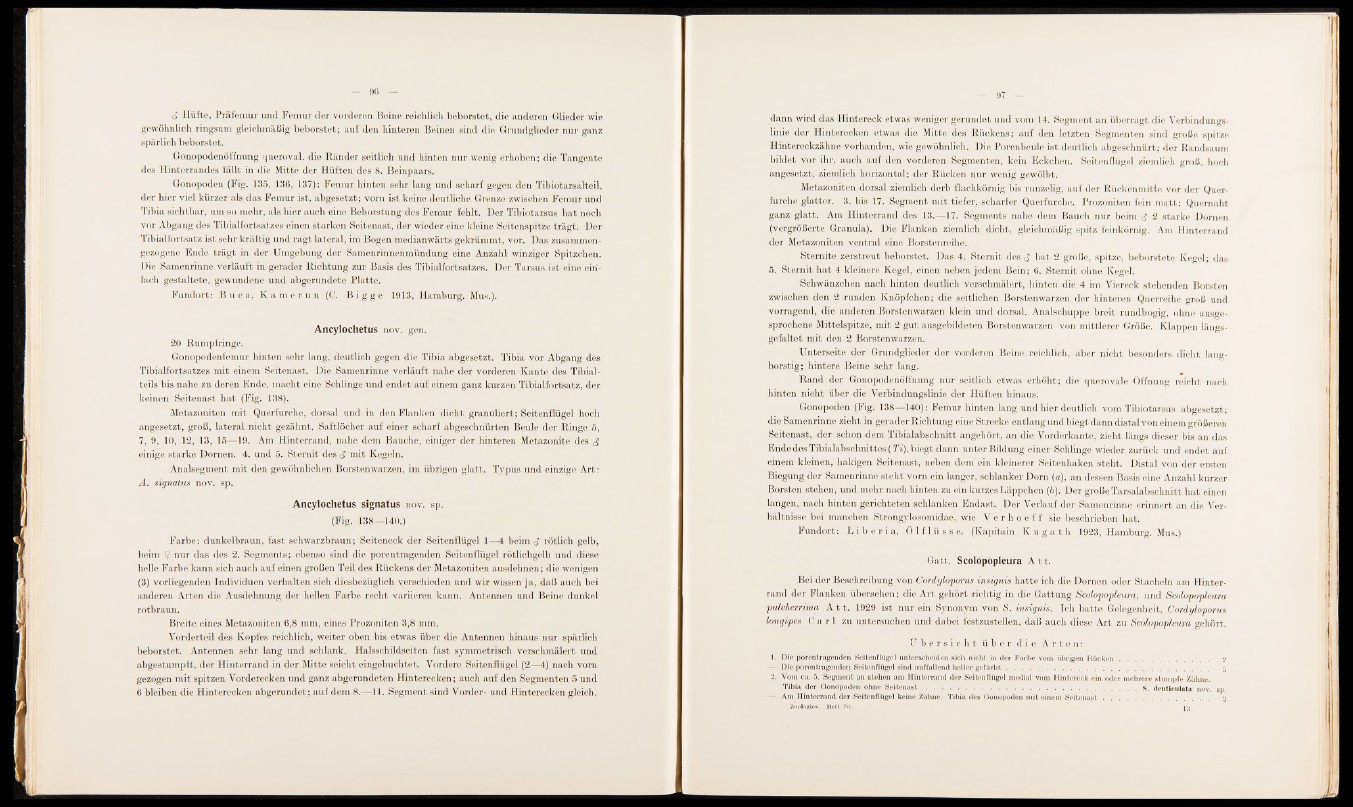
& Hüfte, Präfemur und Femur der vorderen Beine reichlich beborstet, die anderen Glieder wie
gewöhnlich ringsum gleichmäßig beborstet; auf den hinteren Beinen sind die Grundglieder nur ganz
spärlich beborstet.
Gonopodenöffnung queroval, die Ränder seitlich und hinten nur wenig erhoben; die Tangente
des Hinterrandes fällt in die Mitte der Hüften des 8. Beinpaars.
Gonopoden (Fig. 135, 136, 137): Femur hinten sehr lang und scharf gegen den Tibiotarsalteil,
der hier viel kürzer als das Femur ist, abgesetzt; vorn ist keine deutliche Grenze zwischen Femur und
Tibia sichtbar, um so mehr, als hier auch eine Beborstung des Femur fehlt. Der Tibiotarsus h a t noch
vor Abgang des Tibialfortsatzes einen starken Seitenast, der wieder eine kleine Seitenspitze trägt. Der
Tibialfortsatz ist sehr kräftig und ragt lateral, im Bogen medianwärts gekrümmt, vor. Das zusammengezogene
Ende trägt in der Umgebung der Samenrinnenmündung eine Anzahl winziger Spitzchen.
Die Samenrinne verläuft in gerader Richtung zur Basis des Tibialfortsatzes. Der Tarsus ist eine einfach
gestaltete, gewundene und abgerundete Platte.
Fundort: B u c a , K a m e r u n (C. B i g g e 1913, Hamburg. Mus.).
Ancylochetus nov. gen.
20 Rumpfringe.
Gonopodenfemur hinten sehr lang, deutlich gegen die Tibia abgesetzt. Tibia vor Abgang des
Tibialfortsatzes mit einem Seitenast. Die Samenrinne verläuft nahe der vorderen Kante des Tibial-
teils bis nahe zu deren Ende, macht eine Schlinge und endet auf einem ganz kurzen Tibialfortsatz, der
keinen Seitenast h a t (Fig. 138).
Metazoniten mit Querfurche, dorsal und in den Flanken dicht granuliert; Seitenflügel hoch
angesetzt, groß, lateral nicht gezähnt, Saftlöcher auf einer scharf abgeschnürten Beule der Ringe 5,
7, 9, 10, 12, 13, 15—19. Am Hinterrand, nahe dem Bauche, einiger der hinteren Metazonite des $
einige starke Dornen. 4. und 5. Sternit des <$ mit Kegeln.
Analsegment mit den gewöhnlichen Borstenwarzen, im übrigen glatt. Typus und einzige Art:
A. signatus nov. sp.
Ancylochetus signatus nov. sp.
(Fig. 138—140.)
Farbe: dunkelbraun, fast schwarzbraun; Seiteneck der Seitenflügel 1—4 beim <$ rötlich gelb,
beim $ nur das des 2. Segments; ebenso sind die porentragenden Seitenflügel rötlichgelb und diese
helle Farbe kann sich auch auf einen großen Teil des Rückens der Metazoniten ausdehnen; die wenigen
(3) vorliegenden Individuen verhalten sich diesbezüglich verschieden und wir wissen ja, daß auch bei
anderen Arten die Ausdehnung der hellen Farbe recht variieren kann. Antennen und Beine dunkel
rotbraun.
Breite eines Metazoniten 6,8 mm, eines Prozoniten 3,8 mm.
Vorderteil des Kopfes reichlich, weiter oben bis etwas über die Antennen hinaus nur spärlich
beborstet. Antennen sehr lang und schlank. Halsschildseiten fast symmetrisch verschmälert und
abgestumpft, der Hinterrand in der Mitte seicht eingebuchtet. Vordere Seitenflügel (2—4) nach vorn
gezogen mit spitzen Vorderecken und ganz abgerundeten Hinterecken; auch auf den Segmenten 5 und
6 bleiben die Hinterecken abgerundet; auf dem 8.—11. Segment sind Vorder- und Hinterecken gleich,
dann wird das Hintereck etwas weniger gerundet und vom 14. Segment an überragt die Verbindungslinie
der Hinterecken etwas die Mitte des Rückens; auf den letzten Segmenten sind große spitze
Hintereckzähne vorhanden, wie gewöhnlich. Die Porenbeule ist deutlich abgeschnürt; der Randsaum
bildet vor ihr, auch auf den vorderen Segmenten, kein Eckchen. Seitenflügel ziemlich groß, hoch
angesetzt, ziemlich horizontal; der Rücken nur wenig gewölbt.
Metazoniten dorsal ziemlich derb flachkörnig bis runzelig, auf der Rückenmitte vor der Querfurche
glatter. 3. bis 17. Segment mit tiefer, scharfer Querfurche. Prozoniten fein m a tt; Quemaht
ganz glatt. Am Hinterrand des 13.—17. Segments nahe dem Bauch nur beim <$ 2 starke Dornen
(vergrößerte Granula). Die Flanken ziemlich dicht, gleichmäßig spitz feinkörnig. Am Hinterrand
der Metazoniten ventral eine Borstenreihe.
Sternite zerstreut beborstet. Das 4. Sternit des $ h a t 2 große, spitze, beborstete Kegel; das
5. Sternit h a t 4 kleinere Kegel, einen neben jedem Bein; 6. Sternit ohne Kegel.
Schwänzchen nach hinten deutlich verschmälert, hinten die 4 im Viereck stehenden Borsten
zwischen den 2 runden Knöpfchen; die seitlichen Borstenwarzen der hinteren Querreihe groß und
vorragend, die anderen Borstenwarzen klein und dorsal. Analschuppe breit rundbogig, ohne ausgesprochene
Mittelspitze, mit 2 gut ausgebildeten Borstenwarzen von mittlerer Größe. Klappen längsgefaltet
mit den 2 Borstenwarzen.
Unterseite der Grundglieder der vorderen Beine reichlich, aber nicht besonders dicht langborstig;
hintere Beine sehr lang.
Rand der Gonopodenöffnung nur seitlich etwas erhöht; die querovale Öffnung reicht nach
hinten nicht über die Verbindungslinie der Hüften hinaus.
Gonopoden (Fig. 138—140): Femur hinten lang und hier deutlich vom Tibiotarsus abgesetzt;
die Samenrinne zieht in gerader Richtung eine Strecke entlang und biegt dann distal von einem größeren
Seitenast, der schon dem Tibialabschnitt angehört, an die Vorderkante, zieht längs dieser bis an das
Ende des Tibialabschnittes {Ti), biegt dann unter Bildung einer Schlinge wieder zurück und endet auf
einem kleinen, hakigen Seitenast, neben dem ein kleinerer Seitenhaken steht. Distal von der ersten
Biegung der Samenrinne steht vorn ein langer, schlanker Dorn (a), an dessen Basis eine Anzahl kurzer
Borsten stehen, und mehr nach hinten zu ein kurzes Läppchen (b). Der große Tarsalabschnitt h a t einen
langen, nach hinten gerichteten schlanken Endast. Der Verlauf der Samenrinne erinnert an die Verhältnisse
bei manchen Strongylosomidae, wie V e r h o e f f sie beschrieben hat.
Fundort: L i b e r i a , Ö l f l ü s s e . (Kapitain K u g a t h 1923, Hamburg. Mus.)
Gatt. Scolopopleura At t .
Bei der Beschreibung von Cordyloporus insignis hatte ich die Dornen oder Stacheln am Hinterrand
der Flanken übersehen; die Art gehört richtig in die Gattung Scolopopleura, und Scolopopleura
pulcherrima A t t . 1929 ist nur ein Synonym von S. insignis. Ich ha tte Gelegenheit, Cordyloporus
longipes C a r l zu untersuchen und dabei festzustellen, daß auch diese Art zu Scolopopleura gehört.
Ü b e r s i c h t ü b e r d i e A r t e n :
1 . Die porentragenden Seitenflügel unterscheiden sich nicht in der Farbe vom übrigen R ü c k e n ............................................... 2
— Die porentragenden Seitenflügel sind auffallend heller g e f ä r b t ..................................................................................... ’ j ] ’ 5
2. Vom ca. 5. Segment an stehen am Hinterrand der Seitenflügel medial vom Hintereck ein oder mehrere stumpfe Zähne.
Tibia der Gonopoden ohne S e i t e n a s t....................................................................................... s. dentlculata nov. sp.
— Am Hinterrand der Seitenflügel keine Zähne. Tibia des Gonopoden mit einem S e ite n a s t........................................................ 3
Zoologien. « 1 1 1 13