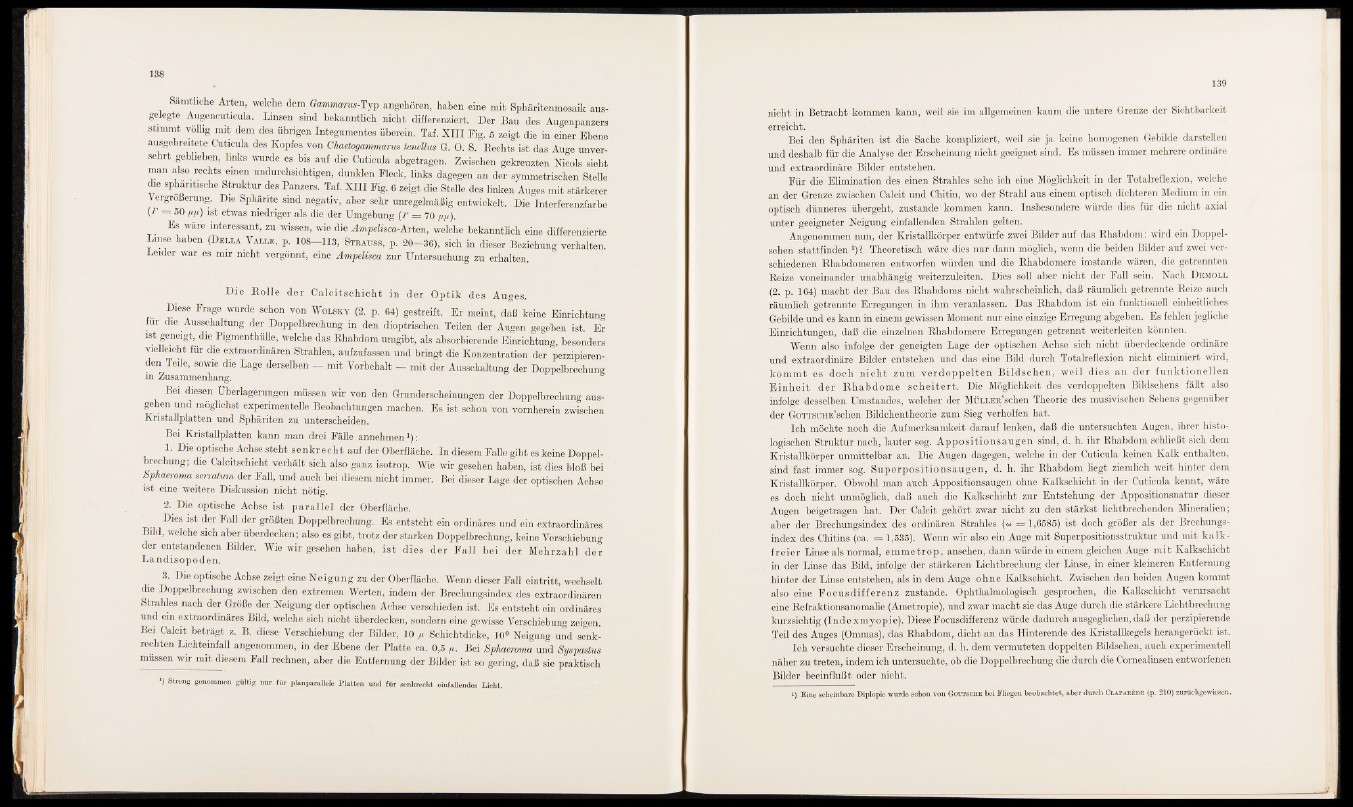
Sämtliche Arten, welche dem Gammarus-Typ angehören, haben eine mit Sphäritenmosaik ausr
gelegte Augencuticula. Luisen sind bekanntlich nicht differenziert. Der Bau des Augenpanzers
stimmt völlig mit dem des übrigep Integumentes überein. Taf. X I II Fig. 5 zeigt die in einer Ebene
ausgebreitete Cuticula des Kopfes von Chaelogammams tenellm G. 0 . S. Bechts ist das Auge unver-
se t geblieben, links wurde es bis auf die Cuticula abgetragen. Zwischen gekreuzten Nicols sieht
man also rechts einen undurchsichtigen, dunklen Fleck, links dagegen an der symmetrischen Stelle
die sphantische Struktur des Panzers. Taf. X I I I Fig. 6 zeigt die Stehe des linken Auges mit stärkerer
Vergrößerung. Die Sphärite smd negativ, aber sehr unregelmäßig entwickelt. Die Interferenzfarbe
( r — 50 nn) ist etwas niedriger als die der Umgebung ( r = 70 ¡x[x).
Es wäre interessant, zu wissen, wie die ^mpeZi'sca-Arten, welche bekanntlich eine differenzierte
Linse haben (D e l l a V a l l e , p 108—113, S t e a u s s , p. 20—36), sich in dieser Beziehung verhalten.
Leider war es mir nicht vergönnt, eine AmpeUsca zur Untersuchung zu erhalten.
D ie B o lle d e r C a lc its c h ic h t in d e r O p tik d e s Auges.
Diese Frage wurde schon von W o l s k y (2. p . 64) gestreift. E r meint, daß keine Einrichtung
für die Ausschaltung der Doppelbrechung in den dioptrischen Teilen der Augen'gegeben ist. Er
ist geneigt, die Pigmenthülle, welche das Bhabdom umgibt, als absorbierende Einrichtung, besonders
vielleicht für die extraordinären Strahlen, aufzufassen und bringt die Konzentration der perzipieren-
den Teüe, sowie die Lage derselben ■ mit Vorbehalt -B m it der Ausschaltung der Doppelbrechung
m Zusammenhang.
Bei diesen Überlagerungen müssen wir von den Grunderscheinungen der Doppelbrechung ausgehen
und möglichst experimentelle Beobachtungen machen. Es ist schon von vornherein zwischen
Kristallplatten und Sphäriten zu unterscheiden.
Bei Kristallplatten kann man drei Fälle annehmen *):
1. Die optische Achse steht s e n k r e c h t auf der Oberfläche. In diesem Fähe gibt es keine Doppelbrechung;
die Calcitschicht verhält sich also ganz isotrop. Wie wir gesehen haben, ist dies bloß bei
Sphaeroma serratum der Fall, und auch bei diesem nicht immer. Bei dieser Lage der optischen Achse
ist eine weitere Diskussion nickt nötig.
2. Die optische Achse ist p a r a l l e l der Oberfläche.
Dies ist der Fall der größten Doppelbrechung. Es entsteht ein ordinäres und ein extraordinäres
Bild, welche sich aber überdecken; also es gibt, trotz der starken Doppelbrechung, keine Verschiebung
der entstandenen Bilder. Wie wir gesehen haben, ist- d ie s d e r F a ll b e i d e r M e h rz a h l d e r
L a n d is o p o d e n .
3. Die optische Achse zeigt eine N e ig u n g zu der Oberfläche. Wenn dieser Fall eintritt, wechselt
die Doppelbrechung zwischen den extremen Werten, indem der Brechungsindex des extraordinären
Strahles nach der Größe der Neigung der optischen Achse verschieden ist. Es entsteht ein ordinäres
und ein extraordinäres Bild, welche sich nicht überdecken, sondern eine gewisse Verschiebung zeigen.
Bei Calcit beträgt z. B. diese Verschiebung der Bilder, 10 p Schichtdicke, 10° Neigung und senkrechten
Lichteinfall angenommen, in der Ebene der Platte ca. 0,6 p. Bei Sphaeroma und Syspastus
müssen wir mit diesem Fall rechnen, aber die Entfernung der Bilder ist so gering, daß sie praktisch
*) Streng genommen gültig nur für planparallele Platten und für senkrecht einfallendes Licht.
nickt; in Betrackt kommen kann, weil sie im allgemeinen kaum die unterò Grenze der Sichtbarkeit
erreickt.
Bei den Spkäriten ist die Sacke kompliziert, weil sie ja keine komogenen Gebilde dar stellen
und deshalb für die Analyse der Erscheinung nickt geeignet sind. Es müssen immer mehrere ordinäre
und extraordinäre Bilder entstehen.
Für die Elimination des einen Strahles sehe ick eine Möglichkeit in der Totalreflexion, welche
an der Grenze zwischen Calcit und Chitin, wo der Strahl aus einem optisch dichteren Medium in ein
optisch dünneres übergeht, zustande kommen kann. Insbesondere würde dies für die nicht axial
unter geeigneter Neigung einfallenden Strahlen gelten.
Angenommen nun, der Kristallkörper entwürfe zwei Bilder auf das Bhabdom : wird ein Doppelsehen
sta ttfin d en 1)? Theoretisch wäre dies nur dann möglich, wenn die beiden Bilder auf zwei verschiedenen
Bhabdomeren entworfen würden und die Bhabdomere imstande wären, die getrennten
Beize voneinander unabhängig weiterzuleiten. Dies soll aber nicht der Fall sein. Nach D em o l l
(2. p. 164) macht der Bau des Bhabdoms nicht wahrscheinlich, daß räumlich getrennte Beize auch
räumlich getrennte Erregungen in ihm veranlassen. Das Bhabdom ist ein funktionell einheitliches
Gebilde und es kann in einem gewissen Moment nur eine einzige Erregung abgeben. Es fehlen jegliche
Einrichtungen, daß die einzelnen Bhabdomere Erregungen getrennt weiterleiten könnten.
Wenn also infolge der geneigten Lage der optischen Achse sich nicht überdeckende ordinäre
und extraordinäre Bilder entstehen und das eine Bild durch Totalreflexion nicht eliminiert wird,
k om m t es d o c h n i c h t zum v e r d o p p e lte n B ild s e h e n , w e il d ie s a n d e r fu n k tio n e lle n
E in h e i t d e r B h a b d om e s c h e ite r t. Die Möglichkeit des verdoppelten Bildsehens fällt also
infolge desselben Umstandes, welcher der MüLLER’schen Theorie des musivischen Sehens gegenüber
der GoTTSCHE’schen Bildchentheorie zum Sieg verholfen hat.
Ich möchte noch die Aufmerksamkeit darauf lenken, daß die untersuchten Augen, ihrer histologischen
Struktur nach, lauter sog. A p p o s itio n s a u g e n sind, d. h. ihr Bhabdom schließt sich dem
Kristallkörper unmittelbar an. Die Augen dagegen, welche in der Cuticula keinen Kalk enthalten,
sind fast immer sog. S u p e r p o s itio n s a u g e n , d. h. ihr Bhabdom liegt ziemlich weit hinter dem
Kristallkörper. Obwohl man auch Appositionsaugen ohne Kalkschicht in der Cuticula kennt, wäre
es doch nicht unmöglich, daß auch die Kalkschicht zur Entstehung der Appositionsnatur dieser
Augen beigetragen hat. Der Calcit gehört zwar nicht zu den stärkst lichtbrechenden Mineralien;
aber der Brechungsindex des ordinären Strahles (w = 1,6585) ist doch größer als der Brechungsindex
des Chitins (ca. = 1,535). Wenn wir also ein Auge mit Superpositionsstruktur und mit k a lk f
r e ie r Linse als normal, em m e tro p , ansehen, dann würde in einem gleichen Auge m it Kalkschicht
in der Linse das Bild, infolge der stärkeren Lichtbrechung der Linse, in einer kleineren Entfernung
hinter der Linse entstehen, als in dem Auge o h n e Kalkschicht. Zwischen den beiden Augen kommt
also eine F o c u s d if f e r e n z zustande. Ophthalmologisch gesprochen, die Kalkschicht verursacht
eine Befraktionsanomalie (Ametropie), und zwar macht sie das Auge durch die stärkere Lichtbrechung
kurzsichtig (In d e xm y o p ie ). Diese Focusdifferenz würde dadurch ausgeglichen, daß der perzipierende
Teil des Auges (Ommas), das Bhabdom, dicht an das Hinfcerende des Kristallkegels herangerückb ist.
Ich versuchte dieser Erscheinung, d. h. dem vermuteten doppelten Bildsehen, auch experimentell
näher zu treten, indem ich untersuchte, ob die Doppelbrechung die durch die Cornealinsen entworfenen
Bilder beeinflußt oder nicht.
1) Eine scheinbare Diplopie wurde schon von G o tt so h e bei Fliegen beobachtet, aber durch Cla pa h ^d e (p. 210) zurückgewiesen.