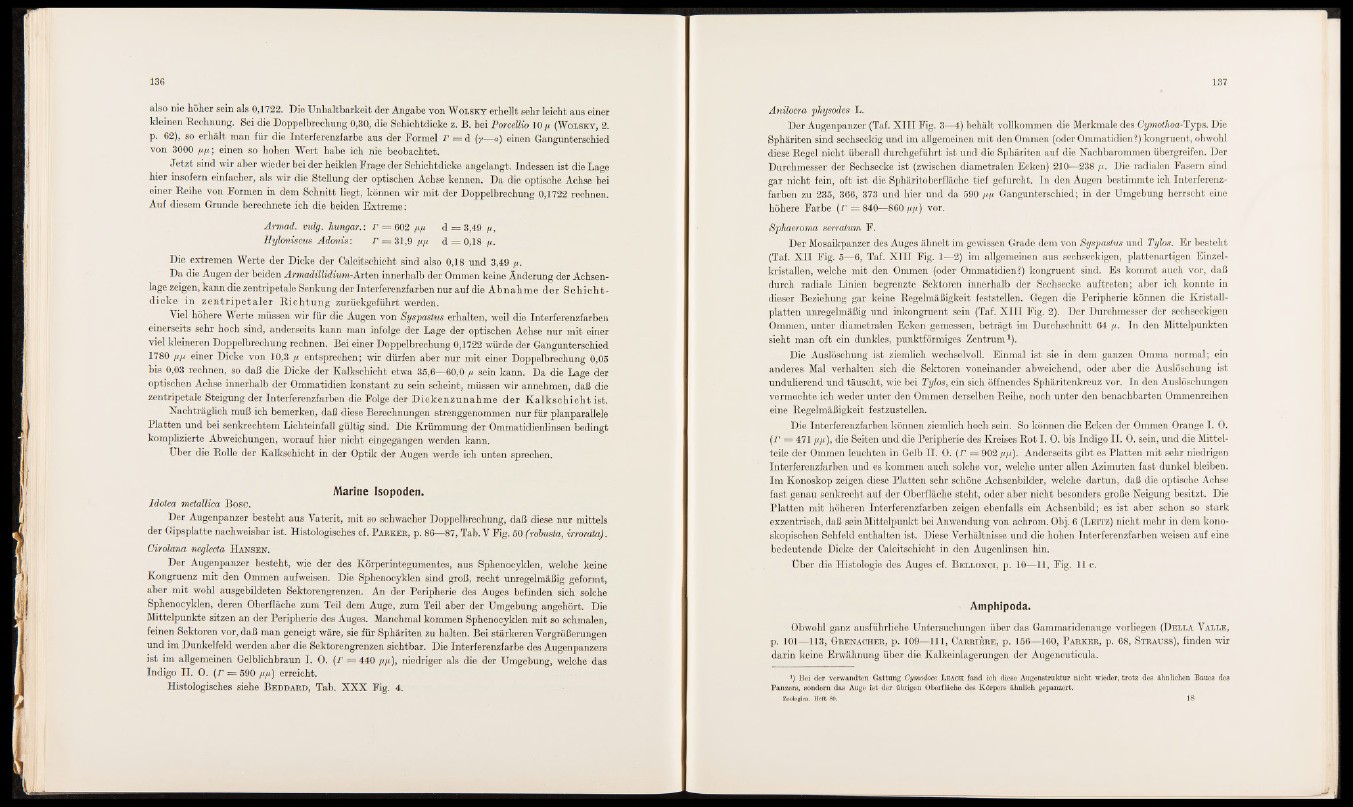
also nie höher sein als 0,1722. Die Unhaltbarkeit der Angabe von W o l s k y erhellt sehr leicht aus einer
kleinen Rechnung. Sei die Doppelbrechung 0,30., die Schichtdicke z. B. bei Porcellio 10 y (W o l s k y , 2.
p. 62), so erhält man für die Interferenzfarbe aus der Formel r = d (y— a ) einen Gangunterschied
von 3000 y/x; einen so hohen Wert habe ich nie beobachtet.
J e tz t sind wir aber wieder bei der heiklen Frage der Schichtdicke angelangt. Indessen ist die Lage
hier insofern einfacher, als wir die Stellung der optischen Achse kennen. Da die optische Achse bei
einer Reihe von Formen in dem Schnitt liegt, können wir mit der Doppelbrechung 0,1722 rechnen.
Auf diesem Grunde berechnete ich die beiden Extreme:
Armad. vulg. hungar.: r =='602 fxp d = 3,49 [x,
Hyloniscm Adonis: r — 31,9 ¡xy d — 0,18 fx.
Die extremen Werte der Dicke der Calcitschicht sind also 0,18 und 3,49 /x.
Da die Augen der beiden Armadillidium-Aiten innerhalb der Ommen keine Änderung der Achsenlage
zeigen, kann die zentripetale Senkung der Interferenzfarben nur auf die A b n a hm e d e r S c h i c h t d
ic k e in z e n t r ip e t a l e r R i c h tu n g zurückgeführt werden.
Viel höhere Werte müssen wir für die Augen von Syspastus erhalten, weil die Interferenzfarben
einerseits sehr hoch sind, anderseits kann man infolge der Lage der optischen Achse nur mit einer
viel kleineren Doppelbrechung rechnen. Bei einer Doppelbrechung 0,1722 würde der Gangunterschied
1780 fx/x einer Dicke von 10,3 y entsprechen; wir dürfen aber nur mit einer Doppelbrechung 0,05
bis 0,03 rechnen, so daß die Dicke der Kalkschicht etwa 35,6—60,0 ¡x sein kann. Da die Lage der
optischen Achse innerhalb der Ommatidien konstant zu sein scheint, müssen wir annehmen, daß die
zentripetale Steigung der Interferenzfarben die Folge der D ic k e n z u n a hm e d e r K a lk s c h ic h t ist.
Nachträglich muß ich bemerken, daß diese Berechnungen strenggenommen nur für planparallele
Platten und bei senkrechtem Lichteinfall gültig sind. Die Krümmung der Ommatidienlinsen bedingt
komplizierte Abweichungen, worauf hier nicht eingegangen werden kann.
Über die Rolle der Kalkschicht in der Optik der Augen werde ich unten sprechen.
Marine Isopoden.
Idotea metallica Bose.
Der Augenpanzer besteht aus Yaterit, mit so schwacher Doppelbrechung, daß diese nur mittels
der Gipsplatte nachweisbar ist. Histologisches cf. P a r k e r , p. 86—87, Tab. V Fig. 50 (robusta, inorata).
Cirolana neglecta H a n s e n .
Der Augenpanzer besteht, wie der des Körperintegumentes, aus Sphenocyklen, welche keine
Kongruenz mit den Ommen aufweisen. Die Sphenocyklen sind groß, recht unregelmäßig geformt,
aber mit wohl ausgebildeten Sektorengrenzen. An der Peripherie des Auges befinden sich solche
Sphenocyklen, deren Oberfläche zum Teil dem Auge, zum Teil aber der Umgebung angehört. Die
Mittelpunkte sitzen an der Peripherie des Auges. Manchmal kommen Sphenocyklen mit so schmalen,
feinen Sektoren vor, daß man geneigt wäre, sie für Sphäriten zu halten. Bei stärkeren Vergrößerungen
und im Dunkelfeld werden aber die Sektorengrenzen sichtbar. Die Interferenzfarbe des Augenpanzers
ist im allgemeinen Gelblichbraun I. O. ( r = 440 jx/x), niedriger als die der Umgebung, welche das
Indigo II. O. (r = 590 fx/x) erreicht.
Histologisches siehe B e d d a r d , Tab. XXX Fig. 4 .
Anilocra pJiysodes L.
Der Augenpanzer (Taf. X I II Fig. 3—4) behält vollkommen die Merkmale des Cymothoa-Typs. Die
Sphäriten sind sechseckig und im allgemeinen mit den Ommen (oder Ommatidien?) kongruent, obwohl
diese Regel nicht überall durchgeführt ist und die Sphäriten auf die Nachbarommen übergreifen. Der
Durchmesser der Sechsecke ist (zwischen diametralen Ecken) 210—238 y. Die radialen Fasern sind
gar nicht fein, oft ist die Sphäritoberfläche tief gefurcht. In den Augen bestimmte ich Interferenzfarben
zu 235, 366, 373 und hier und da 590 fx/x Gangunterschied; in der Umgebung herrscht eine
höhere Farbe ( r = 840—860 y/x) vor.
Sphaeroma serratum F.
Der Mosaikpanzer des Auges ähnelt im gewissen Grade dem von Syspastus und Tyb s. E r besteht
(Taf. X II Fig. 5—6, Taf. X I II Fig. 1—2) im allgemeinen aus sechseckigen, plattenartigen Einzelkristallen,
welche mit den Ommen (oder Ommatidien?) kongruent sind. Es kommt auch vor, daß
durch radiale Linien begrenzte Sektoren innerhalb der Sechsecke auftreten; aber ich konnte in
dieser Beziehung gar keine Regelmäßigkeit feststellen. Gegen die Peripherie können die Kristallplatten
unregelmäßig und inkongruent sein (Taf. X I II Fig. 2). Der Durchmesser der sechseckigen
Ommen, unter diametralen Ecken gemessen, beträgt im Durchschnitt 64 ¡x. In den Mittelpunkten
sieht man oft ein dunkles, punktförmiges Zentrum1).
Die Auslöschung ist ziemlich wechselvoll. Einmal ist sie in dem ganzen Omma normal; ein
anderes Mal verhalten sich die Sektoren voneinander abweichend, oder aber die Auslöschung ist
undulierend und täuscht, wie bei Tybs, ein sich öffnendes Sphäritenkreuz vor. In den Auslöschungen
vermochte ich weder unter den Ommen derselben Reihe, noch unter den benachbarten Ommenreihen
eine Regelmäßigkeit festzustellen.
Die Interferenzfarben können ziemlich hoch sein. So können die Ecken der Ommen Orange I. 0.
(J1 .== 471 /x[x), die Seiten und die Peripherie des Kreises R ot I. 0 . bis Indigo II. 0 . sein, und die Mittelteile
der Ommen leuchten in Gelb II. 0 . ( r = 902 ¡x/x). Anderseits gibt es Platten mit sehr niedrigen
Interferenzfarben und es kommen auch solche vor, welche unter allen Azimuten fast dunkel bleiben.
Im Konoskop zeigen diese Platten sehr schöne Achsenbilder, welche dartun, daß die optische Achse
fast genau senkrecht auf der Oberfläche steht, oder aber nicht besonders große Neigung besitzt. Die
Platten mit höheren Interferenzfarben zeigen ebenfalls ein Achsenbild; es ist aber schon so stark
exzentrisch, daß sein Mittelpunkt bei Anwendung von achrom. Obj. 6 (L e it z ) nicht mehr in dem kono-
skopischen Sehfeld enthalten ist. Diese Verhältnisse und die hohen Interferenzfarben weisen auf eine
bedeutende Dicke der Calcitschicht in den Augenlinsen hin.
Uber die Histologie des Auges cf. B e l l o n c i , p. 10—11, Fig. 11 c.
Amphipoda.
Obwohl ganz ausführliche Untersuchungen über das Gammaridenauge vorliegen (D e l l a V a l l e ,
p. 101—113, G r e n a c h e r , p. 109—111, Ca r r ie r e , p. 156—160, P a r k e r , p. 68, S t r a u s s ), finden wir
darin keine Erwähnung über die Kalkeinlagerungen der Augencuticula.
x) Bei der verwandten Gattung Cymodoce L e a c h fand ich diese Augenstruktur nicht wieder, trotz des ähnlichen Baues des
Panzers, sondern das Auge ist der übrigen Oberfläche des Körpers ähnlich gepanzert.
Zoologica. Heft 80. 18