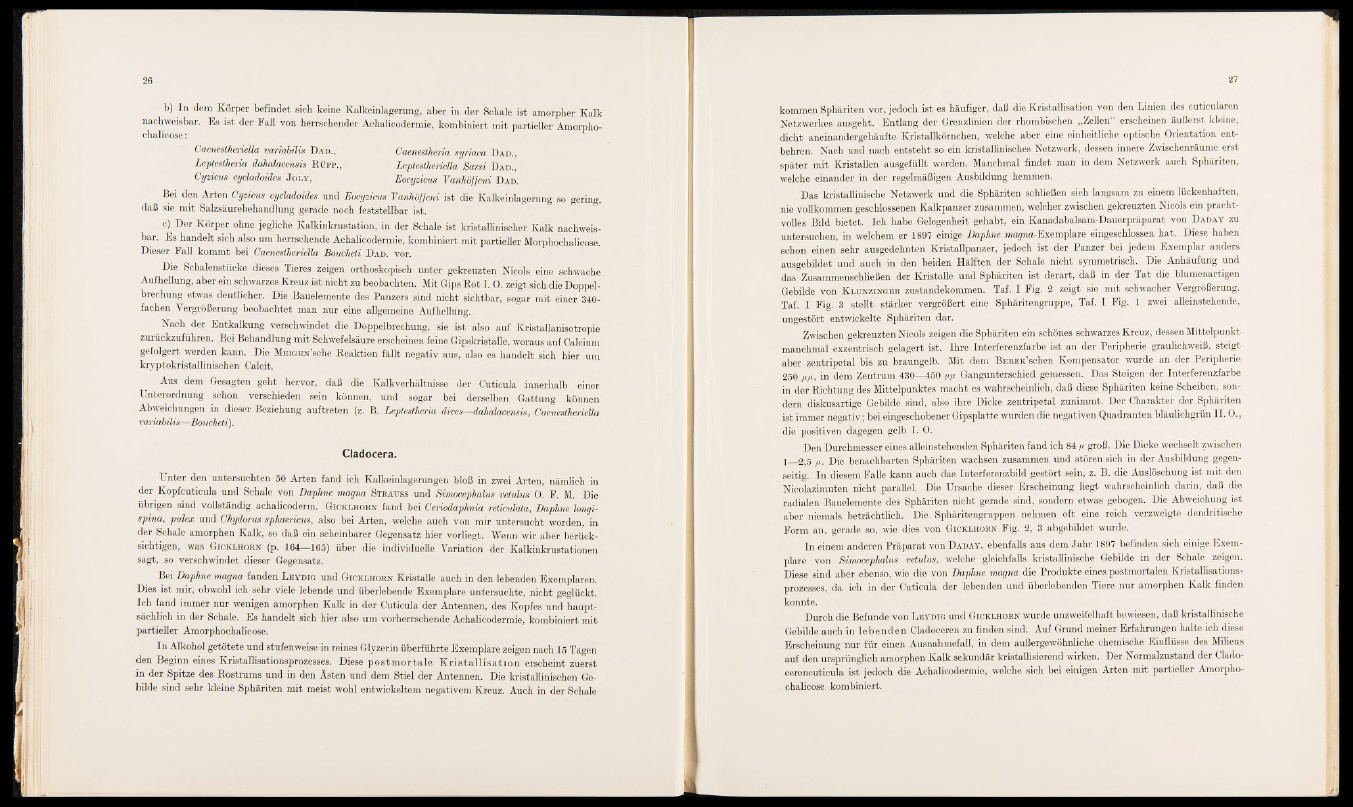
b) In dem Körper befindet sieb keine Kalkeinlagerung, aber in der Schale ist amorpher Kalk
nachweisbar. Es ist der Pall von herrschender Achalicodermie, kombiniert mit partieller Amorpho-
chalicose:
CaenestherieUa variabilis D a d . , Caenestheria syriaca D a d . ,
Leptestheria dahalacensis Kü v i \ , LeptestherieUa Sarsi D a d . ,
Cyzicm cychdoides J o l y , Eocyzicus Vanhöffeni D a d .
Bei den Arten Cyzicm cydadoides und Eocyzicus Vanhöffeni ist die Kalkeinlagerung so gering,
daß sie mit Salzsäurebehandlung gerade noch feststellbar ist.
e) Der Körper ohne jegliche Kalkinkrustation, in der Schale ist kristallinischer Kalk nachweisbar.
Es handelt sich also um herrschende Achalicodermie, kombiniert mit partieller Morphochalicose.
Dieser Pall kommt bei CaenestherieUa Boucheti D a d . vor.
Die Schalenstiicke dieses Tieres zeigen orthoskopisch unter gekreuzten Nicols eine schwache
Aufhellung, aber ein schwarzes Kreuz ist nicht zu beobachten. Mit Gips R o t I. 0. zeigt sich die Doppelbrechung
etwas deutlicher. Die Bauelemente des. Panzers sind nicht sichtbar, sogar mit einer 340-
fachen Vergrößerung beobachtet man nur eine allgemeine Aufhellung.
Nach der Entkalkung verschwindet die Doppelbrechung, sie ist also auf Kristallanisotropie
zurückzuführen. Bei Behandlung m it Schwefelsäure erscheinen feine Gipskristalle, woraus auf Calcium
gefolgert werden kann. Die MEiGEN’sche Reaktion fällt negativ aus, also es ¡iandc.lt sich hier um
kryptokristallinischen Calcit.
Aus dem Gesagten geht hervor, daß die Kalkverhältnisse der Cuticula innerhalb einer
Unterordnung schon verschieden sein können, und sogar bei derselben Gattung können
Abweichungen in dieser Beziehung auftreten (z. B. Leptestheria dives—dahalacensis, CaenestherieUa
variabilis—Boucheti).
Cladocera.
Unter den untersuchten 50 Arten fand ich Kalkeinlagerungen bloß in zwei Arten, nämlich in
der Kopfcuticula und Schale von Daphne magna S t r a u s s und Simocephalus vetulus 0 . F. M. Die
übrigen sind vollständig achalicoderm. G i c k l h o r n fand bei Ceriodaphnia reticulata, Daphne Imgi-
spina, pulex und Chydorus sphaericus, also bei Arten, welche auch von mir untersucht worden, in -
der Schale amorphen Kalk, so daß ein scheinbarer Gegensatz hier vorliegt. Wenn wir aber berücksichtigen,
was G i c k l h o r n (p. 164—165) über die individuelle Variation der Kalkinkrüstationen
sagt, so verschwindet dieser Gegensatz.
Bei Daphne magna fanden L e y d i g und G i c k l h o r n Kristalle auch in den lebenden Exemplaren.
Dies ist mir, obwohl ich sehr viele lebende und überlebende Exemplare untersuchte, nicht geglückt.
Ich fand immer nur wenigen amorphen Kalk in der Cuticula der Antennen, des Kopfes und hauptsächlich
in der Schale. Es handelt sich hier also um vorherrschende Achalicodermie, kombiniert mit
partieller Amorphochalicose.
In Alkohol getötete und stufenweise in reines Glyzerin überführte Exemplare zeigen nach 15 Tagen
den Beginn eines Kristallisationsprozesses. Diese p o s tm o r ta le K r i s t a l l i s a t io n erscheint zuerst
in der Spitze des Rostrums und in den Ästen und dem Stiel der Antennen. Die kristallinischen Gebilde
sind sehr kleine Sphäriten mit meist wohl entwickeltem negativem Kreuz. Auch in der Schale
kommen Sphäriten vor, jedoch ist es häufiger, daß die Kristallisation von den Linien des cuticularen
Netzwerkes ausgeht. Entlang der Grenzlinien der rhombischen „Zellen“ erscheinen äußerst kleine,
dicht aneinandergehäufte Kristallkömchen, welche aber eine einheitliche optische Orientation entbehren.
Nach und nach entsteht so ein- kristallinisches Netzwerk, dessen innere Zwischenräume erst
später mit Kristallen ausgefüllt werden. Manchmal findet man in dem Netzwerk auch Sphäriten,
welche einander in der regelmäßigen Ausbildung hemmen.
Das kristallinische Netzwerk und die Sphäriten schließen sich langsam zu einem lückenhaften,
nie vollkommen geschlossenen Kalkpanzer zusammen, welcher zwischen gekreuzten Nicols ein prachtvolles
Bild bietet. Ich habe Gelegenheit gehabt, ein Kanadabalsam-Dauerpräparat von D a d a y z u
untersuchen, in welchem er 1897 einige Daphne magna-Exemplare eingeschlossen hat. Diese haben
schon einen sehr ausgedehnten Kristallpanzer, jedoch ist der Panzer bei jedem Exemplar anders
ausgebildet und auch in den beiden Hälften der Schale nicht symmetrisch. Die Anhäufung und
das Zusammenschließen der Kristalle und Sphäriten ist derart, daß in der Tat die blumenartigen
Gebilde von K l u n z i n g e r Zustandekommen. Taf. I Fig. 2 zeigt sie mit schwacher Vergrößerung.
Taf. I Fig. 3 stellt) stärker vergrößert eine Sphäritengruppe, Taf. I E ig j|l zwei alleinstehende,
ungestört entwickelte -Sphäriten dar.
Zwischen gekreuzten Nicols zeigen die Sphäriten ein schönes schwarzes Kreuz, dessen Mittelpunkt
manchmal exzentrisch, gelagert ist. Ihre Interferenzfarbe is t'a n der Peripherie graulichweiß, steigt
aber zentripetal bis zu braungelb. Mit dem BEREK’schen Kompensator wurde an der Peripherie
250 pp, in dem Zentrum 430—450 pp Gangunterschied gemessen. Das Steigen der Interferenzfarbe
in der Richtung des Mittelpunktes macht es wahrscheinlich, daß diese Sphäriten keine Scheiben, sondern
diskusartige Gebilde sind, also ihre Dicke zentripetal zunimmt. Der Charakter der Sphäriten
ist immer negativ; bei eingeschobener Gipsplatte wurden die negativen Quadranten bläulichgrün II. 0.,
die positiven dagegen gelb I. 0.
Den Durchmesser eines alleinstehenden Sphäriten fand ich 84 p groß. Die Dicke wechselt zwischen
1_. ‘¿,5 p. Die benachbarten Sphäriten wachsen zusammen und stören sich in der Ausbildung gegenseitig.
In diesem Falle kann auch das Interferenzbild gestört sein, z. B. die Auslöschung ist mit den
Nicolazimuten nicht parallel. Die Ursache dieser‘Erscheinung liegt wahrscheinlich darin, daß die
radialen Bauelemente des Sphäriten nicht gerade sind, Jjähdem etwas gebogen. Die Abweichung ist
aber niemals beträchtlich. Die Sphäritengruppen nehmen oft eine reich verzweigte dendritische
Form an, gerade so, wie dies von G i c k l h o r n Fig. S g b abgebildet wurde.
In einem anderen Präparat von D a d a y , ebenfalls aus dem Ja h r 1897 befinden sich einige Exemplare
von Simocephalus vetulm, welche gleichfalls kristallinische Gebilde in der Schale zeigen.
Diese sind aber ebenso, wie die von Daphne magna die Produkte eines postmortalen Kristallisationsprozesses,
da ich in der Cuticula der lebenden und überlebenden Tiere nur amorphen Kalk finden
konnte.
Durch die Befunde von L e y d ig und G ic k l h o r n wurde unzweifelhaft bewiesen, daß kristallinische
Gebilde auch in le b e n d e n Cladoceren zu finden sind. Auf Grund meiner Erfahrungen halte ich diese
Erscheinung nur für einen Ausnahmefall, in dem außergewöhnliche chemische Einflüsse des Milieus
auf den ursprünglich amorphen Kalk sekundär kristallisierend wirken. Der Normalzustand der Clado-
cerencuticula ist jedoch die Achalicodermie, welche sich bei einigen Arten mit partieller Amorphochalicose
kombiniert,