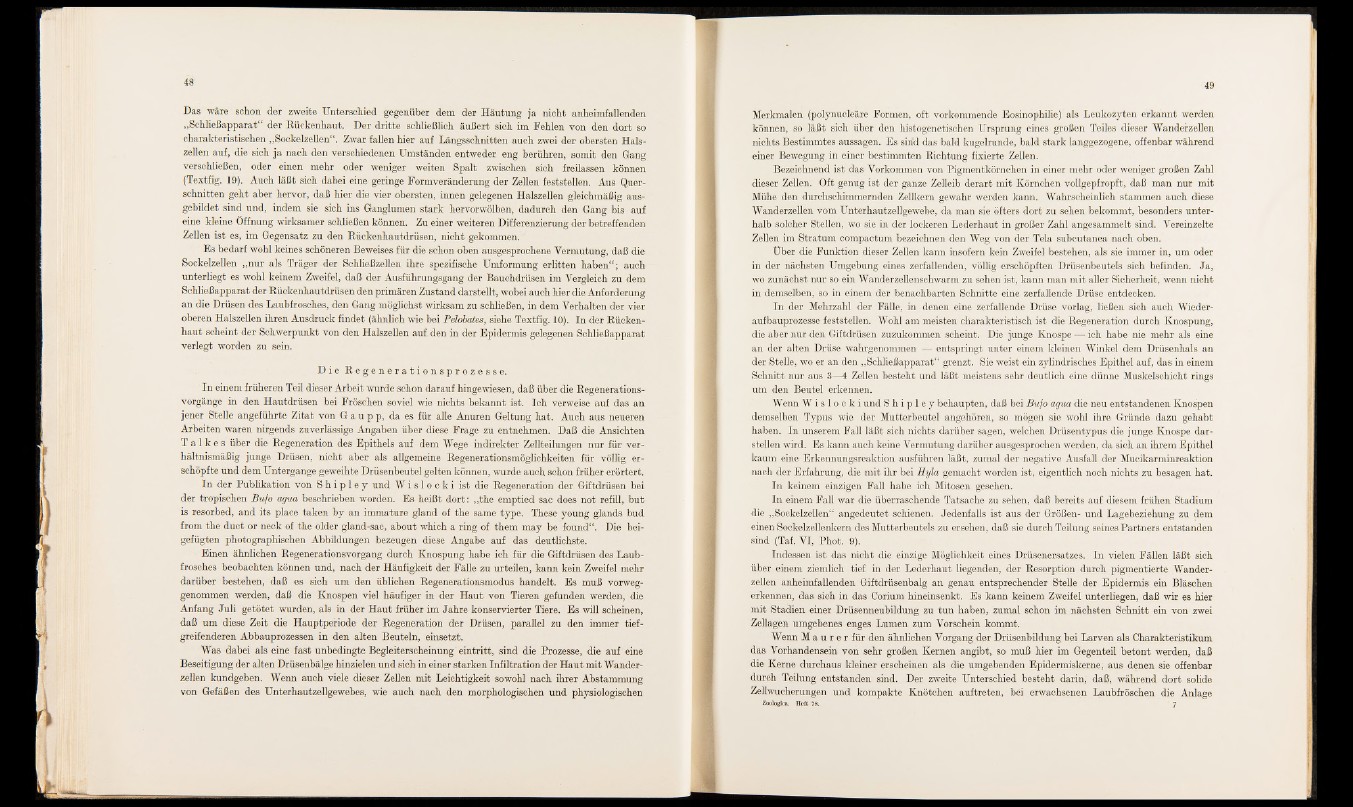
Das wäre schon der zweite Unterschied gegenüber dem der Häutung ja nicht anheimfallenden
„Schließapparat“ der Rückenhaut. Der dritte schließlich äußert sich im Fehlen von den dort so
charakteristischen „Sockelzellen“ . Zwar fallen hier auf Längsschnitten auch zwei der obersten Halszellen
auf, die sich ja nach den verschiedenen Umständen entweder eng berühren, somit den Gang
verschließen, oder einen mehr oder weniger weiten Spalt zwischen sich freilassen können
(Textfig. 19). Auch läßt sich dabei eine geringe Formveränderung der Zellen feststellen. Aus Querschnitten
geht aber hervor, daß hier die vier obersten, innen gelegenen Halszellen gleichmäßig ausgebildet
sind und, indem sie sich ins Ganglumen sta rk hervorwölben, dadurch den Gang bis auf
eine kleine Öffnung wirksamer schließen können. Zu einer weiteren Differenzierung der betreffenden
Zellen ist es, im Gegensatz zu den Rückenhautdrüsen, nicht gekommen.
E s bedarf wohl keines schöneren Beweises für die schon oben ausgesprochene Vermutung, daß die
Sockelzellen „nur als Träger der Schließzellen ihre spezifische Umformung erlitten haben“ ; auch
unterliegt es wohl keinem Zweifel, daß der Ausführungsgang der Bauchdrüsen im Vergleich zu dem
Schließapparat der Rückenhautdrüsen den primären Zustand darstellt, wobei auch hier die Anforderung
an die Drüsen des Laubfrosches, den Gang möglichst wirksam zu schließen, in dem Verhalten der vier
oberen Halszellen ihren Ausdruck findet (ähnlich wie bei Pelobates, siehe Textfig. 10). In der Rückenh
au t scheint der Schwerpunkt von den Halszellen auf den in der Epidermis gelegenen Schließapparat
verlegt worden zu sein.
D i e R e g e n e r a t i o n s p r o z e s s e .
In einem früheren Teil dieser Arbeit wurde schon darauf hingewiesen, daß über die Regenerationsvorgänge
in den Hautdrüsen bei Fröschen soviel wie nichts bekannt ist. Ich verweise auf das an
jener Stelle angeführte Zitat von G a u p p, da es für alle Anuren Geltung hat. Auch aus neueren
Arbeiten waren nirgends zuverlässige Angaben über diese Frage zu entnehmen. Daß die Ansichten
T a l k e s über die Regeneration des Epithels auf dem Wege indirekter Zellteilungen nur für verhältnismäßig
junge Drüsen, nicht aber als allgemeine Regenerationsmöglichkeiten für völlig erschöpfte
und dem Untergange geweihte Drüsenbeutel gelten können, wurde auch schon früher erörtert.
In der Publikation von S h i p 1 e y und W i s l o c k i ist die Regeneration der Giftdrüsen bei
der tropischen Bufo agua beschrieben worden. Es heißt dort: „the emptied sac does not refill, b u t
is resorbed, and its place taken by an immature gland of the same type. These young glands bud
from the duct or neck of the older gland-sac, about which a ring of them may be found“ . Die beigefügten
photographischen Abbildungen bezeugen diese Angabe auf das deutlichste.
Einen ähnlichen Regenerationsvorgang durch Knospung habe ich für die Giftdrüsen des Laubfrosches
beobachten können und, nach der Häufigkeit der Fälle zu urteilen, kann kein Zweifel mehr
darüber bestehen, daß es sich um den üblichen Regenerationsmodus handelt. Es muß vorweggenommen
werden, daß die Knospen viel häufiger in der Hau t von Tieren gefunden werden, die
Anfang Ju li getötet wurden, als in der Hau t früher im Jahre konservierter Tiere. Es will scheinen,
daß um diese Zeit die Hauptperiode der Regeneration der Drüsen, parallel zu den immer tiefgreifenderen
Abbauprozessen in den alten Beuteln, einsetzt.
Was dabei als eine fast unbedingte Begleiterscheinung eintritt, sind die Prozesse, die auf eine
Beseitigung der alten Drüsenbälge hinzielen und sich in einer starken Infiltration der H au t mit Wanderzellen
kundgeben. Wenn auch viele dieser Zellen mit Leichtigkeit sowohl nach ihrer Abstammung
von Gefäßen des Unterhautzellgewebes, wie auch nach den morphologischen und physiologischen
Merkmalen (polynucleäre Formen, oft vorkommende Eosinophilie) als Leukozyten erkannt werden
können, so läßt sich über den histogenetischen Ursprung eines großen Teiles dieser Wanderzellen
nichts Bestimmtes aussagen. Es sin*d das bald kugelrunde, bald sta rk langgezogene, offenbar während
einer Bewegung in einer bestimmten Richtung fixierte Zellen.
Bezeichnend ist das Vorkommen von Pigmentkörnchen in einer mehr oder weniger großen Zahl
dieser Zellen. Oft genug ist der ganze Zelleib derart mit Körnchen vollgepfropft, daß man nur mit
Mühe den durchschimmernden Zellkern gewahr werden kann. Wahrscheinlich stammen auch diese
Wanderzellen vom Unterhautzellgewebe, da man sie öfters dort zu sehen bekommt, besonders unterhalb
solcher Stellen, wo sie in der lockeren Lederhaut in großer Zahl angesammelt sind. Vereinzelte
Zellen im Stratum compactum bezeichnen den Weg von der Tela subcutanea nach oben.
Uber die Funktion dieser Zellen kann insofern kein Zweifel bestehen, als sie immer in, um oder
in der nächsten Umgebung eines zerfallenden, völlig erschöpften Drüsenbeutels sich befinden. Ja ,
wo zunächst nur so ein Wanderzellenschwarm zu sehen ist, kann man mit aller Sicherheit, wenn nicht
in demselben, so in einem der benachbarten Schnitte eine zerfallende Drüse entdecken.
In der Mehrzahl der Fälle, in denen eine zerfallende Drüse vorlag, ließen sich auch Wiederaufbauprozesse
feststellen. Wohl am meisten charakteristisch ist die Regeneration durch Knospung,
die aber nur den Giftdrüsen zuzukommen scheint. Die junge Knospe — ich habe nie mehr als eine
an der alten Drüse wahrgenommen — entspringt unter einem kleinen Winkel dem Drüsenhals an
der Stelle, wo er an den „Schließapparat“ grenzt. Sie weist ein zylindrisches Epithel auf, das in einem
Schnitt nur aus 3—4 Zellen besteht und läßt meistens sehr deutlich eine dünne Muskelschicht rings
um den Beutel erkennen.
Wenn W i s l o c k i und S h i p 1 e y behaupten, daß bei Bufo agua die neu entstandenen Knospen
demselben Typus wie der Mutterbeutel angehören, so mögen sie wohl ihre Gründe dazu gehabt
haben. In unserem Fall läß t sich nichts darüber sagen, welchen Drüsentypus die junge Knospe darstellen
wird. Es kann auch keine Vermutung darüber ausgesprochen werden, da sich an ihrem Epithel
kaum eine Erkennungsreaktion ausführen läßt, zumal der negative Ausfall der Mucikarminreaktion
nach der Erfahrung, die mit ihr bei Hyla gemacht worden ist, eigentlich noch nichts zu besagen hat.
In keinem einzigen Fall habe ich Mitosen gesehen.
In einem Fall war die überraschende Tatsache zu sehen, daß bereits auf diesem frühen Stadium
die „Sockelzellen“ angedeutet schienen. Jedenfalls ist aus der Größen- und Lagebeziehung zu dem
einen Sockelzellenkern des Mutterbeutels zu ersehen, daß sie durch Teilung seines Partners entstanden
sind (Taf. VI, Phot. 9).
Indessen ist das nicht die einzige Möglichkeit eines Drüsenersatzes. In vielen Fällen läßt sich
über einem ziemlich tief in der Lederhaut liegenden, der Resorption durch pigmentierte Wanderzellen
anheimfallenden Giftdrüsenbalg an genau entsprechender Stelle der Epidermis ein Bläschen
erkennen, das sich in das Corium hineinsenkt. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß wir es hier
mit Stadien einer Drüsenneubildung zu tun haben, zumal schon im nächsten Schnitt ein von zwei
Zellagen umgebenes enges Lumen zum Vorschein kommt.
Wenn M a u r e r für den ähnlichen Vorgang der Drüsenbildung bei Larven als Charakteristikum
das Vorhandensein von sehr großen Kernen angibt, so muß hier im Gegenteil betont werden, daß
die Kerne durchaus kleiner erscheinen als die umgebenden Epidermiskerne; aus denen sie offenbar
durch Teüung entstanden sind. Der zweite Unterschied besteht darin, daß, während dort solide
Zellwucherungen und kompakte Knötchen auftreten, bei erwachsenen Laubfröschen die Anlage
Zoologlca. Heft 78. ' 7