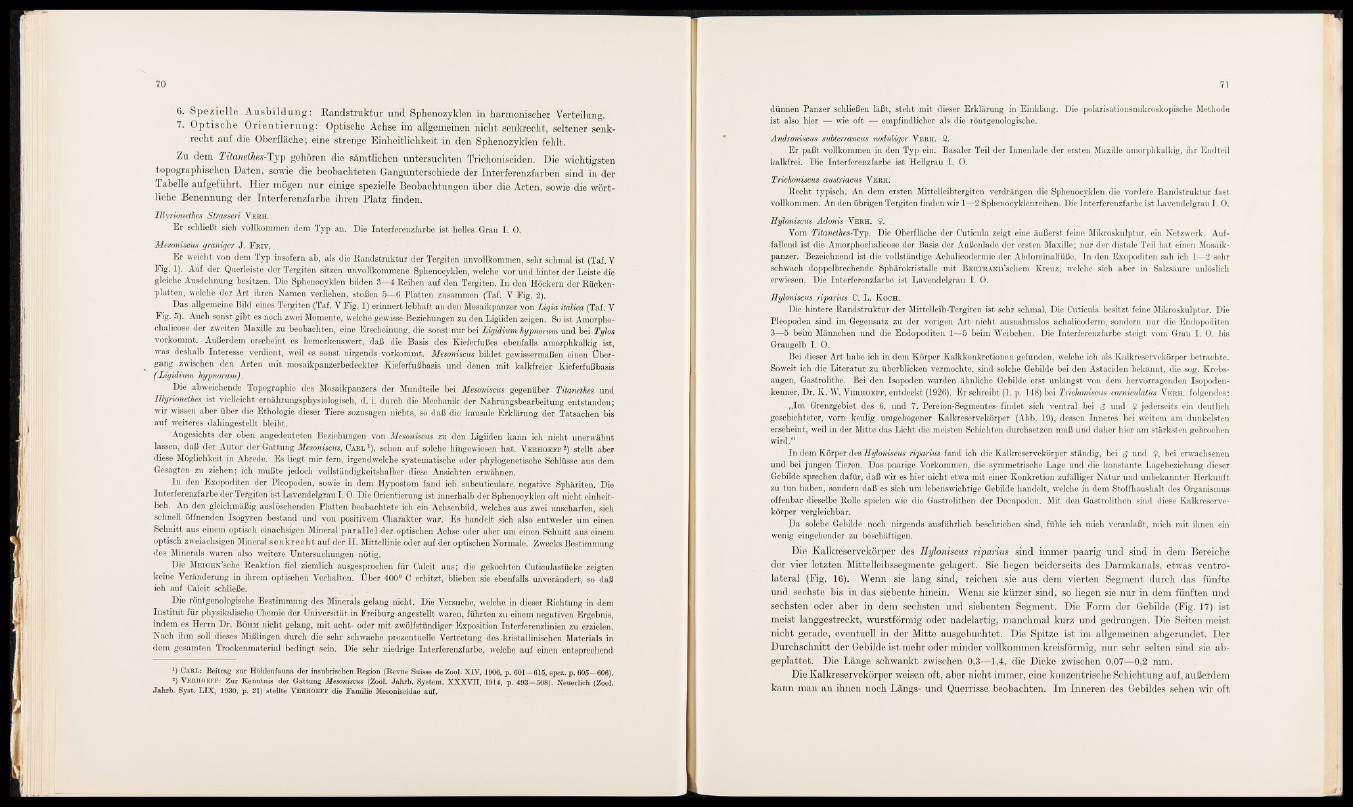
6. S p e z ie lle A u s b ild u n g : Randstruktur und Sphenozyklen in harmonischer Verteilung.
7. O p tis c h e O r ie n tie ru n g : Optische Achse im allgemeinen nicht senkrecht, seltener senkrecht
auf die Oberfläche; eine strenge Einheitlichkeit in den Sphenozyklen fehlt.
Zu dem Titanethes-Typ gehören die sämtlichen untersuchten Trichonisciden. Die wichtigsten
topographischen Daten, sowie die beobachteten Gangunterschiede der Interferenzfarben sind in der
Tabelle aufgeführt. Hier mögen nur einige spezielle Beobachtungen über die Arten, sowie die wörtliche
Benennung der Interferenzfarbe ihren Platz finden.
Illyrionethes Strassen V e r h .
Er schließt sich vollkommen dem Typ an. Die Interferenzfarbe ist helles Grau I. 0.
Mesoniscus graniger J. Friv.
Er weicht von dem Typ insofern ab, als die Randstruktur der Tergiten unvollkommen, sehr schmal ist (Taf. V
Fig. 1). Auf der Querleiste der Tergiten sitzen unvollkommene. Sphenocyklen, welche vor und hinter der Leiste die
gleiche Ausdehnung besitzen. Die Sphenocyklen bilden 3—4 Reihen auf den Tergiten. In den Höckern der Rückenplatten,
welche der Art ihren Namen verliehen, stoßen 5— 6 Platten zusammen (Taf. V Fig. 2).
Das allgemeine Bild eines Tergiten (Taf. V Fig. 1) erinnert lebhaft an den Mosaikpanzer von Ligia italica (Taf. V
Fig. 5). Auch sonst gibt es noch zwei Momente, welche gewisse Beziehungen zu den Ligiiden zeigen. So ist Amorpho-
chalicose der zweiten Maxille zu beobachten, eine Erscheinung, die sonst mir bei IÄgidium hypnorum und bei Tylos
vorkommt. Außerdem erscheint es bemerkenswert, daß die Basis des Kieferfußes ebenfalls amorphkalkig ist,
was deshalb Interesse verdient, weü es sonst nirgends vorkommt. Mesoniscus bildet gewissermaßen einen Übergang
zwischen den Arten mit mosaikpanzerbedeckter Kieferfußbasis und denen mit. kalkfreier Kieferfußbasis
(Ligidium Jiypnorum).
Die abweichende Topographie des Mosaikpanzers der Mundteile bei Mesoniscus gegenüber Titanethes und
Illyrionethes ist vielleicht ernährungsphysiologisch, d. i. durch die Mechanik der Nahrungsbearbeitung entstanden;
wir wissen aber über die Ethologie dieser Tiere sozusagen nichts, so daß die kausale Erklärung der Tatsachen bis
auf weiteres dahingestellt bleibt.
Angesichts der oben angedeuteten Beziehungen von Mesoniscus zu den Ligiiden kann ich nicht unerwähnt
lassen, daß der Autor der Gattung Mesoniscus, C a r l *), schon auf solche hingewiesen hat. V e r h o e f f 2) stellt aber
diese Möglichkeit in Abrede. Es liegt mir fern, irgendwelche systematische oder phylogenetische Schlüsse aus dem
Gesagten zu ziehen; ich mußte jedoch vollständigkeitshalber diese Ansichten erwähnen.
In den Exopoditen der Pleopoden, sowie in dem Hypostom fand ich subcuticulare, negative Sphäriten. Die
Interferenzfarbe der Tergiten ist Lavendelgrau 1.0. Die Orientierung ist innerhalb der Sphenocyklen oft nicht einheitlich.
An den gleichmäßig auslöschenden Platten beobachtete ich ein Achsenbild, welches aus zwei unscharfen, sich
schnell öffnenden Isogyren bestand und von positivem Charakter war. Es handelt sich also entweder um einen
Schnitt aus einem optisch einachsigen Mineral parallel der optischen Achse oder aber um einen Schnitt aus einem
optisch zweiachsigen Mineral senkrecht auf der II. Mittellinie oder auf der optischen Normale. Zwecks Bestimmung
des Minerals waren also weitere Untersuchungen nötig.
Die MEiGEN’sche Reaktion fiel ziemlich ausgesprochen für Calcit aus; die gekochten Cuticulastücke zeigten
keine Veränderung in ihrem optischen Verhalten. Über 400° C erhitzt, blieben sie ebenfalls unverändert, so daß
ich auf Calcit schließe.
Die röntgenologische Bestimmung des Minerals gelang nicht. Die Versuche, welche in dieser Richtung in dem
Institut für physikalische Chemie der Universität in Freiburg angestellt waren, führten zu einem negativen Ergebnis,
indem es Herrn Dr. Böhm nicht gelang, mit acht- oder mit zwölf ständiger Exposition Interferenzlinien zu erzielen.
Nach ihm soll dieses Mißlingen durch die sehr schwache prozentuelle Vertretung des kristallinischen Materials in
dem gesamten Trockenmaterial bedingt sein. Die sehr niedrige Interferenzfarbe, welche auf einen entsprechend
!) CARL: Beitrag zur Höhlenfauna der insubrischen Region (Revue Suisse de Zool. XIV, 1906, p. 601—615, spez. p. 605— 606).
2) V e r h o e f f : Zur Kenntnis der Gattung Mesoniscus (Zool. Jahrb. System. XXXVH, 1914, p. 493—508). Neuerlich (Zool.
Jahrb. Syst. LIX, 1930, p. 21) stellte V e r h o e f f .die Familie Mesoniscidae aUf.
dünnen Panzer Schließen läßt, steht mit dieser Erklärung in Einklang. Die polarisationsmikroskopische Methode
ist also hier — wie oft — empfindlicher als die röntgenologische.
Androniscus subterraneus noduliger V e r h . $.
Er paßt vollkommen in den Typ ein. Basaler Teil der Innenlade der ersten Maxille amorphkalkig, ihr Endteil
kalkfrei.- Die Interferenzfarbe ist Hellgrau I. O.
Trichoniscus austriacus V e r h .
Recht typisch. An dem ersten' Mittelleibtergiten verdrängen die Sphenocyklen die vordere Randstruktur fast
vollkommen. An den übrigen Tergiten finden wir 1—2 Sphenocyklenreihen. Die Interferenzfarbe ist Lavendelgrau I. O.
Hyloniscus Adonis V e r h . $.
Vom Titanethes-Typ. Die Oberfläche der Cuticula zeigt eine äußerst feine Mikroskulptur, ein Netzwerk. Auffallend
ist die Amorphochalicose der Basis der Außenlade der ersten Maxille; nur der distale Teil hat einen Mosaikpanzer.
Bezeichnend ist die vollständige Achalicodermie der Abdominalfüße. In den Exopoditen sah ich 1—2 sehr
schwach doppelbrechende Sphärokristalle mit BERTRANü’schem Kreuz, welche sich aber in Salzsäure unlöslich
erwiesen. Die Interferenzfarbe ist Lavendelgrau I. 0.
Hyloniscus riparius C. L. K o c h .
Die hintere Randstruktur der Mittelleib-Tergiten ist sehr schmal. Die Cuticula besitzt feine Mikroskulptur. Die
Pleopoden sind im Gegensatz zu der vorigen Art nicht ausnahmslos achalicoderm,' sondern nur die Endopoditen
3—5 beim Männchen und die Endopoditen 1—5 beim Weibchen. Die Interferenzfarbe steigt vom Grau I. 0. bis
Graugelb I. 0.
Bei dieser Art habe ich in dem Körper Kalkkonkretionen gefunden, welche ich als Kalkreservekörper betrachte.
Soweit ich die Literatur zu überblicken vermochte, sind solche Gebilde bei den Astaciden bekannt, die sog. Krebsaugen,
Gastrolithe. Bei den Isopoden wurden ähnliche Gebüde erst unlängst von dem hervorragenden Isopoden-
kenner, Dr. K. W. V e rh o e ff, entdeckt (1926). Er schreibt (1. p. 148) bei Trichoniscus corniculatus V e rh . folgendes:
„Im Grenzgebiet des 6. und 7. Pereion-Segmentes findet sich ventral bei <J und § jederseits ein deutlich
geschichteter, vorn keulig umgebogener Kalkreservekörper (Abb. 19), dessen Inneres bei weitem am dunkelsten
erscheint, weil in der Mitte das Licht die meisten Schichten durchsetzen muß und daher hier am stärksten gebrochen
wird.“
In dem Körper des Hyloniscus riparius fand ich die Kalkreservekörper ständig, bei <J und $, bei erwachsenen
und bei jungen Tieren. Das paarige Vorkommen, die symmetrische Lage und die konstante Lagebeziehung dieser
Gebilde sprechen dafür, daß wir es hier nicht etwa mit einer Konkretion zufälliger Natur und unbekannter Herkunft
zu tun haben, sondern daß es. sich um lebenswichtige Gebilde handelt, welche in dem Stoffhaushalt des Organismus
offenbar dieselbe Rolle spielen wie die Gastrolithen der Decapoden. Mit den Gastrolithen sind diese Kalkreservekörper
vergleichbar.
Da solche Gebilde noch nirgends ausführlich beschrieben sind, fühle ich mich veranlaßt, mich mit ihnen ein
wenig eingehender zu beschäftigen.
Die Kalkreservekörper des Hyloniscus riparius sind immer paarig und sind in dem Bereiche
der vier letzten Mittelleibssegmente gelagert. Sie liegen beiderseits des Darmkanals, etwas ventro-
lateral (Fig. 16). Wenn sie lang sind, reichen sie aus dem vierten Segment durch das fünfte
und sechste bis in das siebente hinein. Wemi sie kürzer sind, so liegen sie nur in dem fünften und
sechsten oder aber in dem sechsten und siebenten Segment. Die Form der Gebilde (Fig. 17) ist
meist langgestreckt, wurstförmig oder nadelartig, manchmal kurz und gedrungen. Die Seiten meist
nicht gerade, eventuell in der Mitte ausgebuchtet. Die Spitze ist im allgemeinen abgerundet. Der
Durchschnitt der Gebilde ist mehr oder minder vollkommen kreisförmig, nur sehr selten sind sie abgeplattet.
Die Länge schwankt zwischen 0,3—1,4, die Dicke zwischen 0,07—0,2 mm.
Die Kalkreservekörper weisen oft, aber nicht immer, eine konzentrische Schichtung auf, außerdem
kann man an ihnen noch Längs- und Querrisse beobachten. Im Inneren des Gebüdes sehen wir oft