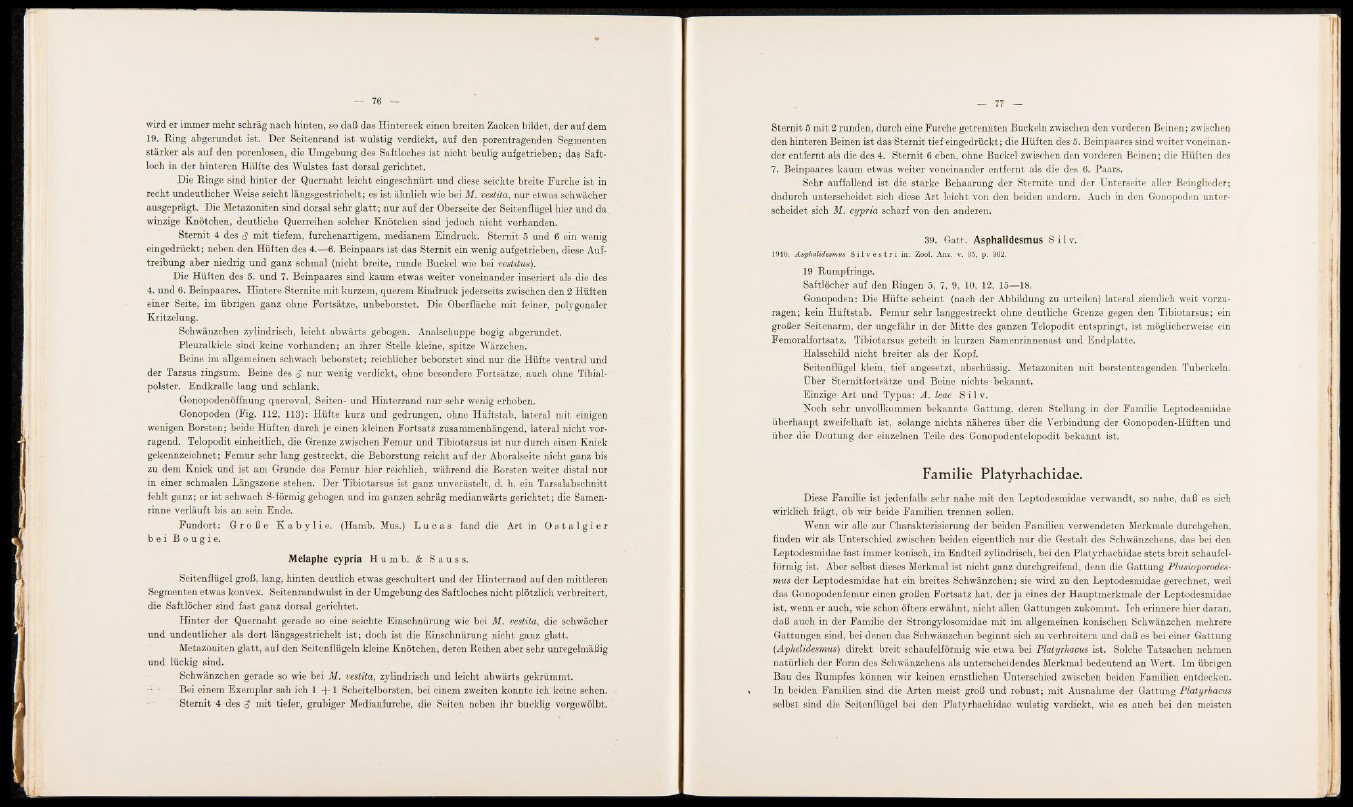
wird er immer mehr schräg nach hinten, so daß das Hintereck einen breiten Zacken bildet, der auf dem
19. Ring abgerundet ist. Der Seitenrand ist wulstig verdickt, auf den porentragenden Segmenten
stärker als auf den porenlosen, die Umgebung des Saftloches ist nicht beulig aufgetrieben; das Saftloch
in der hinteren Hälfte des Wulstes fast dorsal gerichtet.
Die Ringe sind hinter der Quernaht leicht eingeschnürt und diese seichte breite Furche ist in
recht undeutlicher Weise seicht längsgestrichelt; es ist ähnlich wie bei M. vestita, nur etwas schwächer
ausgeprägt. Die Metazoniten sind dorsal sehr glatt; nur auf der Oberseite der Seitenflügel hier und da.
winzige Knötchen, deutliche Querreihen solcher Knötchen sind jedoch nicht vorhanden.
Sternit 4 des $ mit tiefem, furchenartigem, medianem Eindruck. Sternit 5 und 6 ein wenig
eingedrückt; neben den Hüften des 4 .- 6 . Beinpaars ist das Sternit ein wenig auf getrieben, diese Auftreibung
aber niedrig und ganz schmal (nicht breite, runde Buckel wie bei vestitus).
Die Hüften des 5. und 7. Beinpaares sind kaum etwas weiter voneinander inseriert als die des
4. und 6. Beinpaares. Hintere Sternite mit kurzem, querem Eindruck jederseits zwischen den 2 Hüften
einer Seite, im übrigen ganz ohne Fortsätze, unbeborstet. Die Oberfläche mit feiner, polygonaler
Kritzelung.
Schwänzchen zylindrisch, leicht abwärts gebogen. Analschuppe bogig abgerundet.
Pleuralkiele sind keine vorhanden; an ihrer Stelle kleine, spitze Wärzchen.
Beine im allgemeinen schwach beborstet; reichlicher beborstet sind nur die Hüfte ventral und
der Tarsus ringsum. Beine des S nur wenig verdickt, ohne besondere Fortsätze, auch ohne Tibial-
polster. Endkralle lang und schlank.
Gonopodenöffnung queroval, Seiten- und Hinterrand nur sehr wenig erhoben.
Gonopoden (Fig. 112, 113): Hüfte kurz und gedrungen, ohne Hüftstab, lateral mit einigen
wenigen Borsten; beide Hüften durch je einen kleinen Fortsatz zusammenhängend, lateral nicht vorragend.
Telopodit einheitlich, die Grenze zwischen Femur und Tibiotarsus ist nur durch einen Knick
gekennzeichnet; Femur sehr lang gestreckt, die Beborstung reicht auf der Aboralseite nicht ganz bis
zu dem Knick und ist am Grunde des Femur hier reichlich, während die Borsten weiter distal nur
in einer schmalen Längszone stehen. Der Tibiotarsus ist ganz unverästelt, d. h. ein Tarsalabschnitt
fehlt ganz; er ist schwach S-förmig gebogen und im ganzen schräg medianwärts gerichtet; die Samenrinne
verläuft bis an sein Ende.
Fundort: G r o ß e K a b y l i e . (Hamb. Mus.) L u c a s fand die Art in O s t a l g i e r
b e i B o u g i e .
Melaphe cypria H u m b . & S a u s s.
Seitenflügel groß, lang, hinten deutlich etwas geschultert und der Hinterrand auf den mittleren
Segmenten etwas konvex. Seitenrandwulst in der Umgebung des Saftloches nicht plötzlich verbreitert,
die Saftlöcher sind fast ganz dorsal gerichtet.
Hinter der Quernaht gerade so eine seichte Einschnürung wie bei M. vestita, die schwächer
und undeutlicher als dort längsgestrichelt ist; doch ist die Einschnürung nicht ganz glatt.
Metazoniten glatt, auf den Seitenflügeln kleine Knötchen, deren Reihen aber sehr unregelmäßig
und lückig sind.
Schwänzchen gerade so wie bei M. vestita, zylindrisch und leicht abwärts gekrümmt.
Bei einem Exemplar sah ich 1 + 1 Scheitelborsten, bei einem zweiten konnte ich keine sehen.
S te rn it-4 des '<$ mit tiefer, grubiger Medianfurche, die Seiten neben ihr bucklig vorgewölbt.
Sternit 5 mit 2 runden, durch eine Furche getrennten Buckeln zwischen den vorderen Beinen; zwischen
den hinteren Beinen ist das Sternit tief eingedrückt; die Hüften des 5. Beinpaares sind weiter voneinander
entfernt als die des 4. Sternit 6 eben, ohne Buckel zwischen den vorderen Beinen; die Hüften des
7. Beinpaares kaum etwas weiter voneinander entfernt als die des 6. Paars.
Sehr auffallend ist die starke Behaarung der Sternite und der Unterseite aller Beinglieder;
dadurch unterscheidet sich diese Art leicht von den beiden ändern. Auch in den Gonopoden unterscheidet
sich M. cypria scharf von den anderen.
39. Gatt. Asphalidesmus S i 1 v.
1910. Asphalidesmus S i l v e s t r i in: Zool. Anz. v. 35, p. 362.
19 Rumpfringe.
Saftlöcher auf den Ringen 5, 7, 9, 10, 12, 15—18.
Gonopoden: Die Hüfte scheint (nach der Abbildung zu urteilen) lateral ziemlich weit vorzuragen;
kein Hüftstab. Femur sehr langgestreckt ohne deutliche Grenze gegen den Tibiotarsus; ein
großer Seitenarm, der ungefähr in der Mitte des ganzen Telopodit entspringt, ist möglicherweise ein
Femoralfortsatz. Tibiotarsus geteilt in kurzen Samenrinnenast und Endplatte.
Halsschild nicht breiter als der Kopf.
Seitenflügel klein, tief angesetzt, abschüssig. Metazoniten mit borstentragenden Tuberkeln.
Über Sternitfortsätze und Beine nichts bekannt.
Einzige Art und Typus: A . leae S i 1 v.
Noch sehr unvollkommen bekannte Gattung, deren Stellung in der Familie Leptodesmidae
überhaupt, zweifelhaft ist, solange nichts näheres über die Verbindung der Gonopoden-Hüften und
über die Deutung der einzelnen Teile des Gonopodentelopodit bekannt ist.
Familie Platyrhachidae.
Diese Familie ist jedenfalls sehr nahe mit den Leptodesmidae verwandt, so nahe, daß es sich
wirklich frägt, ob wir beide Familien trennen sollen.
Wenn wir alle zur Charakterisierung der beiden Familien verwendeten Merkmale durchgehen,
finden wir als Unterschied zwischen beiden eigentlich nur die Gestalt des Schwänzchens, das bei den
Leptodesmidae fast immer konisch, im Endteil zylindrisch, bei den Platyrhachidae stets breit schaufelförmig
ist. Aber selbst dieses Merkmal ist nicht ganz durchgreifend, denn die Gattung Plusioporodes-
mus der Leptodesmidae h a t ein breites Schwänzchen; sie wird zu den Leptodesmidae gerechnet, weil
das Gonopodenfemur einen großen Fortsatz hat, der ja eines der Hauptmerkmale der Leptodesmidae
ist, wenn er auch, wie schon öfters erwähnt, nicht allen Gattungen zukommt. Ich erinnere hier daran,
daß auch in der Familie der Strongylosomidae mit im allgemeinen konischen Schwänzchen mehrere
Gattungen sind, bei denen das Schwänzchen beginnt sich zu verbreitern und daß es bei einer Gattung
(Aphelidesmus) direkt breit' schaufelförmig wie etwa bei Platyrhacus ist. Solche Tatsachen nehmen
natürlich der Form des Schwänzchens als unterscheidendes Merkmal bedeutend an Wert. Im übrigen
Bau des Rumpfes können wir keinen ernstlichen Unterschied zwischen beiden Familien entdecken.
In beiden Familien sind die Arten meist groß und robust; mit Ausnahme der Gattung Platyrhacus
selbst sind die Seitenflügel bei den Platyrhachidae wulstig verdickt, wie es auch bei den meisten