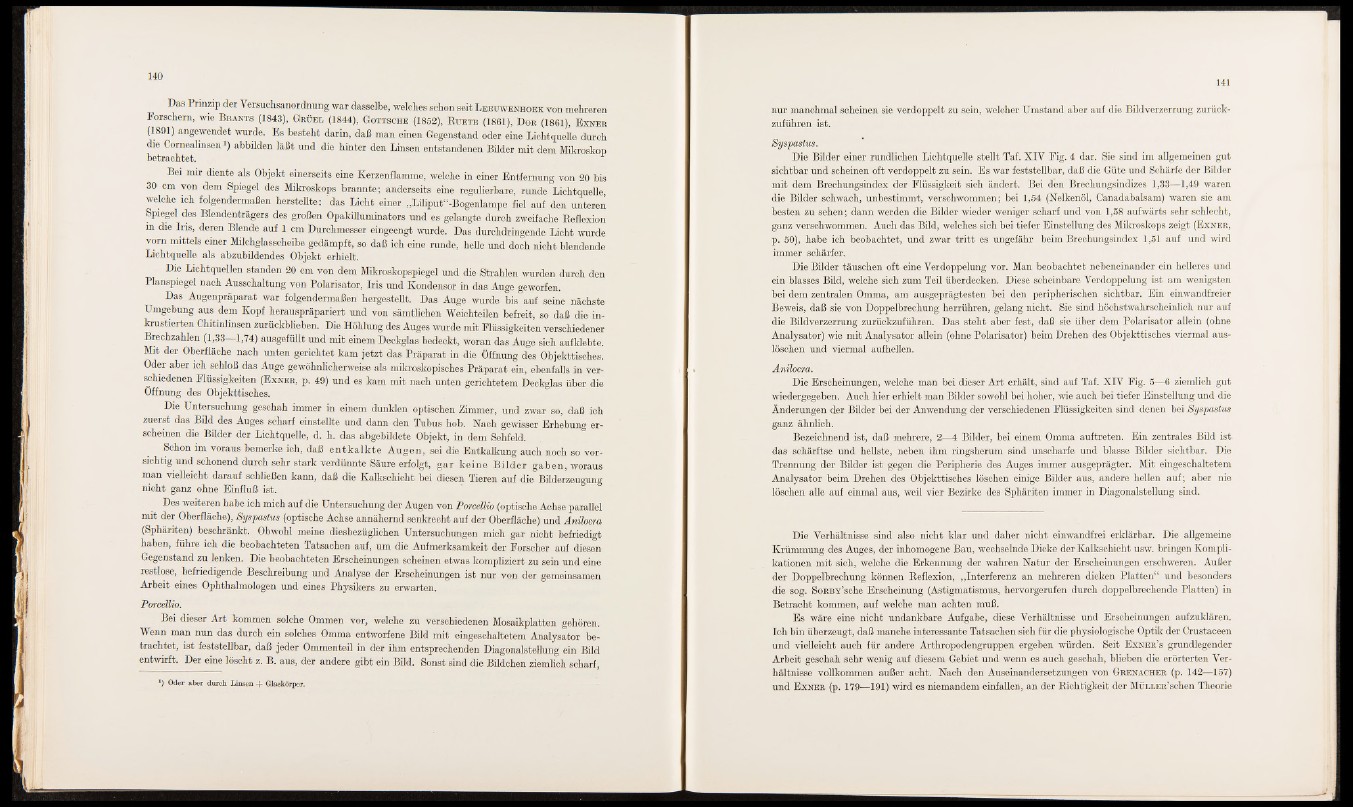
Das Prinzip der Versnchsanordnung war dasselbe, welches schon seit L e e ü w e n h o e k von mehreren
Forschern, wie B r a n t s (1843), G r ü e l (1844), G o t i s c h e (1852), B u e t e (1861), D o r (1861), E x n e r
(1891) angewendet wurde, Es besteht darin, daß man einen Gegenstand oder eine Lichtquelle durch
die Cornealinsen *) abbilden läßt und die hinter den Linsen entstandenen Bilder mit dem Mikroskop
betrachtet.
Bei mir diente als Objekt einerseits eine Kerzenflamme, welche in einer Entfernung von 20 bis
30 cm von dem Spiegel des Mikroskops brannte; anderseits eine regulierbare, runde Lichtquelle,
welche ich folgendermaßen herstellte: das Licht einer „Liliput“-Bogenlampe fiel auf den unteren
Spiegel des Blendenträgers des großen Opakilluminators und es gelangte durch zweifache Keflexion
in die In s, deren Blende auf 1 cm Durchmesser eingeengt wurde. Das durchdringende Licht wurde
vorn mittels einer Milchglasscheibe gedämpft, so daß ich eine runde, helle und doch nicht blendende
Lichtquelle als abzubildendes Objekt erhielt.
Die Lichtquellen standen 20 cm von dem Mikroskopspiegel und die Strahlen wurden durch den
Planspiegel nach Ausschaltung von Polarisator, Iris und Kondensor in das Auge geworfen.
Das Augenpräparat war folgendermaßen hergestellt. Das Auge wurde bis auf seine nächste
Umgebung aus dem Kopf herauspräpariert und von sämtlichen Weiehteilen befreit, so daß die inkrustierten
Chitmlinsen zurückblieben. Die Höhlung des Auges wurde mit Flüssigkeiten verschiedener
Brechzahlen (1 ,3 3 1 ,7 4 ) ausgefüllt und mit einem Deckglas bedeckt, woran das Auge sich aufklebte.
Mit der Oberfläche nach unten gerichtet kam jetzt das Präpara t in die Öffnung des Objekttisches,
Oder aber ich schloß das Auge gewöhnlicherweise als mikroskopisches Präpara t ein, ebenfalls in verschiedenen
Flüssigkeiten (E x n e r , p . 4 9 ) und es kam mit nach unten gerichtetem Deckglas über die
Öffnung des Objekfctisch.es.
Die Untersuchung geschah immer in einem dunklen optischen Zimmer, und zwar so, daß ich
zuerst das Bild des Auges scharf einstellte und dann den Tubus hob. Nach gewisser Erhebung erscheinen
die Bilder der Lichtquelle, d. h. das abgebildete Objekt, in dem Sehfeld.
Schon im voraus bemerke ich, daß e n tk a lk t e A u g e n , sei die Entkalkung auch noch so vorsichtig
und schonend durch sehr stark verdünnte Säure erfolgt, g a r k e in e B ild e r g a b e n , woraus
man vielleicht darauf schließen kann, daß die Kalkschicht bei diesen Tieren auf die Bilderzeugung
nicht ganz ohne Einfluß ist.
Des weiteren habe ich mich auf die Untersuchung der Augen von PtrrcelKo (optische Achse parallel
mit der Oberfläche), Syspastm (optische Achse annähernd senkrecht auf der Oberfläche) und Änüocra
(Sphäriten) beschränkt. Obwohl meine diesbezüglichen Untersuchungen mich gar nicht befriedigt
haben, führe ich die beobachteten Tatsachen auf, um die Aufmerksamkeit der Forscher auf diesen
Gegenstand zu lenken. Die beobachteten Erscheinungen scheinen etwas kompliziert zu sein und eine
restlose, befriedigende Beschreibung und Analyse der Erscheinungen ist nur von der gemeinsamen
Arbeit eines Ophthalmologen und eines Physikers zu erwarten.
Porcellio.
Bei dieser Art kommen solche Ommen vor, welche zu verschiedenen Mosaikplatten gehören.
Wenn man nun das durch ein solches Omina entworfene Bild mit eingeschaltetem Analysator betrachtet,
ist feststellbar, daß jeder Ommenteil in der ihm entsprechenden Diagonalstellung ein Bild
entwirft. Der eine löscht z. B. aus, der andere gibt ein Büd. Sonst sind die Bildchen ziemlich scharf,
J) Oder aber durch Linsen -f- Glaskörper.
nur manchmal scheinen sie verdoppelt zu sein, welcher Umstand aber auf die Bildverzerrung zurückzuführen
ist.
Syspastus.
Die Bilder einer rundlichen Lichtquelle stellt Taf. XIV Fig. 4 dar. Sie sind im allgemeinen gut
sichtbar und scheinen oft verdoppelt zu sein. Es war feststellbar, daß die Güte und Schärfe der Bilder
mit dem Brechungsindex der Flüssigkeit sich ändert. Bei den Brechungsindizes 1,33—1,49 waren
die Bilder schwach, unbestimmt, verschwommen; bei 1,54 (Nelkenöl, Canadabalsam) waren sie am
besten zu sehen; dann werden die Bilder wieder weniger scharf und von 1,58 aufwärts sehr schlecht,
ganz verschwommen. Auch das Bild, welches sich bei tiefer Einstellung des Mikroskops zeigt (E x n e r ,
p. 50), habe ich beobachtet, und zwar tr itt es ungefähr beim Brechungsindex 1,51 auf und wird
immer schärfer.
Die Bilder täuschen oft eine Verdoppelung vor. Man beobachtet nebeneinander ein helleres und
ein blasses Bild, welche sich zum Teil überdecken. Diese scheinbare Verdoppelung ist am wenigsten
bei dem zentralen Omma, am ausgeprägtesten bei den peripherischen sichtbar. Ein einwandfreier
Beweis, daß sie von Doppelbrechung herrühren, gelang nicht. Sie sind höchstwahrscheinlich nur auf
die Bildverzerrung zurückzuführen. Das steht aber fest, daß sie über dem Polarisator allein (ohne
Analysator) wie mit Analysator allein (ohne Polarisator) beim Drehen des Objekttisches viermal auslöschen
und viermal aufhellen.
Anilocra.
Die Erscheinungen, welche man bei dieser Art erhält, sind auf Taf. XIV Fig. 5—6 ziemlich gut
wiedergegeben. Auch hier erhielt man Bilder sowohl bei hoher, wie auch bei tiefer Einstellung und die
Änderungen der Bilder bei der Anwendung der verschiedenen Flüssigkeiten sind denen bei Syspastus
ganz ähnlich.
Bezeichnend ist, daß mehrere, 2—4 Bilder, bei einem Omma auftreten. Ein zentrales Bild ist
das schärftse und hellste, neben ihm ringsherum sind unscharfe und blasse Bilder sichtbar. Die
Trennung der Bilder ist gegen die Peripherie des Auges immer ausgeprägter. Mit eingeschaltetem
Analysator beim Drehen des Objekttisches löschen einige Bilder aus, andere hellen auf; aber nie
löschen alle auf einmal aus, weil vier Bezirke des Sphäriten immer in Diagonalstellung sind.
Die Verhältnisse sind also nicht klar und daher nicht einwandfrei erklärbar, Die allgemeine
Krümmung des Auges, der inhomogene Bau, wechselnde Dicke der Kalkschicht usw. bringen Komplikationen
mit sich, welche die Erkennung der wahren Natur der Erscheinungen erschweren. Außer
der Doppelbrechung können Reflexion, „Interferenz an mehreren dicken Platten“ und besonders
die sog. SoRBY’sche Erscheinung (Astigmatismus, hervorgerufen durch doppelbrechende Platten) in
Betracht kommen, auf welche man achten muß.
Es wäre eine nicht undankbare Aufgabe, diese Verhältnisse und Erscheinungen aufzuklären.
Ich bin überzeugt, daß manche interessante Tatsachen sich für die physiologische Optik der Crustaceen
und vielleicht auch für andere Arthropodengruppen ergeben würden. Seit E x n e r ’s grundlegender
Arbeit geschah sehr wenig auf diesem Gebiet und wenn es auch geschah, blieben die erörterten Verhältnisse
vollkommen außer acht. Nach den Auseinandersetzungen von G r e n a c h e r (p. 142—157)
und E x n e r (p. 179—191) wird es niemandem einfallen, an der Richtigkeit der MüLLER’schen Theorie