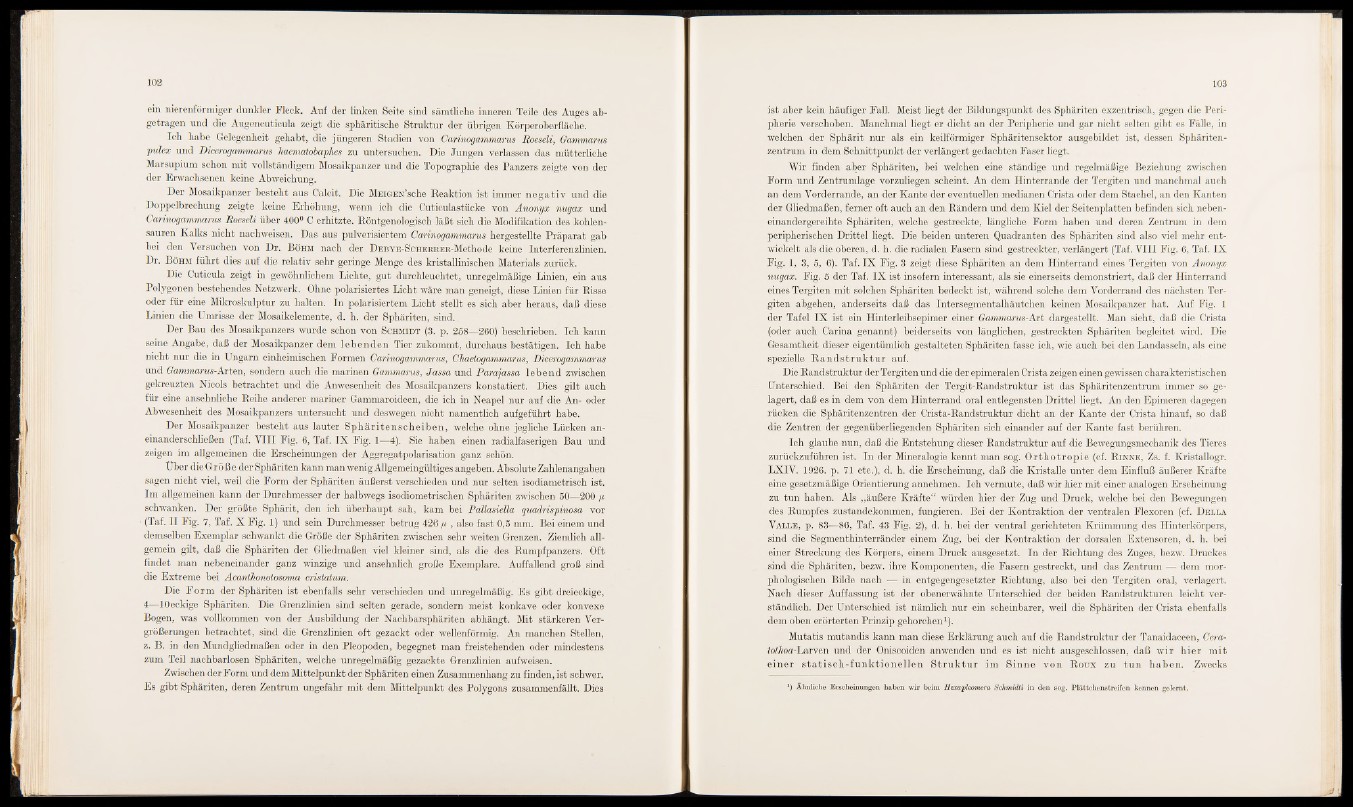
ein nierenförmiger dunkler Fleck. Auf der linken Seite sind sämtliche inneren Teile des Auges abgetragen
und die Augencuticula zeigt die sphäritische Struktur der übrigen Körperoberfläche.
Ick habe Gelegenheit gehabt, die jüngeren Stadien von Carinogammarus Roeseli, Gammarus
pulex und Dicerogammarus haematobaphes zu untersuchen. Die Jungen verlassen das mütterliche
Marsupium schon mit vollständigem Mosaikpanzer und die Topographie des Panzers zeigte von der
der Erwachsenen keine Abweichung.
Der Mosaikpanzer besteht aus Calcit. Die MEiGEN’sche Reaktion ist immer n e g a tiv und die
Doppelbrechung zeigte keine Erhöhung, wenn ich die Cuticulastücke von Anonyx nugax und
Carinogammarus Roeseli über 400° C erhitzte. Röntgenologisch läßt sich die Modifikation des kohlensauren
Kalks nicht nachweisen. Das aus pulverisiertem Carinogammarus hergestellte Präpara t gab
bei den Versuchen von Dr. B ö h m nach der DEBYE-ScHEKRER-Methode keine Interferenzlinien.
Dr. B ö h m führt dies auf die relativ sehr geringe Menge des kristallinischen Materials zurück.
Die Cuticula zeigt in gewöhnlichem Lichte, gut durchleuchtet, unregelmäßige Linien, ein aus
Polygonen bestehendes Netzwerk. Ohne polarisiertes Licht wäre man geneigt, diese Linien für Risse
oder für eine Mikroskulptur zu halten. In polarisiertem Licht stellt es sich aber heraus, daß diese
Linien die Umrisse der Mosaikelemente, d. h. der Sphäriten, sind.
Der Bau des Mosaikpanzers wurde schon von S c h m i d t (3. p. 258—260) beschrieben. Ich kann
seine Angabe, daß der Mosaikpanzer dem le b e n d e n Tier zukommt, durchaus bestätigen. Ich habe
nicht nur die in Ungarn einheimischen Formen Carinogammarus, Chaetogammarus, Dicerogammarus
und Gammarus-Axttn, sondern auch die marinen Gammarus, Jassa und Parajassa le b e n d zwischen
gekreuzten Nicols betrachtet und die Anwesenheit des Mosaikpanzers konstatiert. Dies gilt auch
für eine ansehnliche Reihe anderer mariner Gammaroideen, die ich in Neapel nur auf die An- oder
Abwesenheit des Mosaikpanzers untersucht und deswegen nicht namentlich aufgeführt habe.
Der Mosaikpanzer besteht aus lauter S p h ä r ite n s c h e ib e n , welche ohne jegliche Lücken aneinanderschließen
(Taf. V III Fig. 6, Taf. IX Fig. 1—4). Sie haben einen radialfaserigen Bau und
zeigen im allgemeinen die Erscheinungen der Aggregatpolarisation ganz schön.
Uber die G rö ß e der Sphäriten kann man wenig Allgemeingültiges angeben. Absolute Zahlenangaben
sagen nicht viel, weil die Form der Sphäriten äußerst verschieden und nur selten isodiametrisch ist.
Im allgemeinen kann der Durchmesser der halbwegs isodiometrischen Sphäriten zwischen 50—200 ¡x
schwanken. Der größte Sphärit, den ich überhaupt sah, kam bei Pallasiella quadrispinosa vor
(Taf. I I Fig. 7, Taf. X Fig. 1) und sein Durchmesser betrug 426 ¡x , also fast 0,5 mm. Bei einem und
demselben Exemplar schwankt die Größe der Sphäriten zwischen sehr weiten Grenzen. Ziemlich allgemein
güt, daß die Sphäriten der Gliedmaßen viel kleiner sind, als die des Rumpfpanzers. Oft
findet man nebeneinander ganz winzige und ansehnlich große Exemplare. Auffallend groß sind
die Extreme bei Acanthonotosoma cristatum.
Die F o rm der Sphäriten ist ebenfalls sehr verschieden und unregelmäßig. Es gibt dreieckige,
4—10 eckige Sphäriten. Die Grenzlinien sind selten gerade, sondern meist konkave oder konvexe
Bogen, was vollkommen von der Ausbildung der Nachbarsphäriten abhängt. Mit stärkeren Vergrößerungen
betrachtet, sind die Grenzlinien oft gezackt oder wellenförmig. An manchen Stellen,
z. B. in den Mundgliedmaßen oder in den Pleopoden, begegnet man freistehenden oder mindestens
zum Teil nachbarlosen Sphäriten, welche unregelmäßig gezackte Grenzlinien aufweisen.
Zwischen der Form und dem Mittelpunkt der Sphäriten einen Zusammenhang zu finden, ist schwer.
Es gibt Sphäriten, deren Zentrum ungefähr mit dem Mittelpunkt des Polygons zusammenfällt. Dies
ist aber kein häufiger Fall. Meist liegt der Bildungspunkt des Sphäriten exzentrisch, gegen die Peripherie
verschoben. Manchmal liegt er dicht an der Peripherie und gar nicht selten gibt es Fälle, in
welchen der Sphärit nur als ein keilförmiger Sphäritensektor ausgebildet ist, dessen Sphäriten-
zentrum in dem Schnittpunkt der verlängert gedachten Faser liegt.
Wir finden aber Sphäriten, bei welchen eine ständige und regelmäßige Beziehung zwischen
Form und Zentrumlage vorzuliegen scheint. An dem Hinterrande der Tergiten und manchmal auch
an dem Vorderrande, an der Kante der eventuellen medianen Crista oder dem Stachel, an den Kanten
der Gliedmaßen, ferner oft auch an den Rändern und dem Kiel der Seitenplatten befinden sich nebeneinandergereihte
Sphäriten, welche gestreckte, längliche Form haben und deren Zentrum in dem
peripherischen Drittel liegt. Die beiden unteren Quadranten des Sphäriten sind also viel mehr entwickelt
als die oberen, d. h. die radialen Fasern sind gestreckter, verlängert (Taf. VIII Fig. 6, Taf. IX
Fig. 1, 3, 5, 6). Taf. IX Fig. 3 zeigt diese Sphäriten an dem Hinterrand eines Tergiten von Anonyx
nugax. Fig. 5 der Taf. IX ist insofern interessant, als sie einerseits demonstriert, daß der Hinterrand
eines Tergiten mit solchen Sphäriten bedeckt ist, während solche dem Vorderrand des nächsten Tergiten
abgehen, anderseits daß das Intersegmentalhäutchen keinen Mosaikpanzer hat. Auf Fig. 1
der Tafel IX ist ein Hinterleibsepimer einer Gammarus-Ait dargestellt. Man sieht, daß die Crista
(oder auch Carina genannt) beiderseits von länglichen, gestreckten Sphäriten begleitet wird. Die
Gesamtheit dieser eigentümlich gestalteten Sphäriten fasse ich, wie auch bei den Landasseln, als eine
spezielle R a n d s t r u k tu r auf.
Die Randstruktur der Tergiten und die der epimeralen Crista zeigen einen gewissen charakteristischen
Unterschied. Bei den Sphäriten der Tergit-Randstruktur ist das Sphäritenzentrum immer so gelagert,
daß es in dem von dem Hinterrand oral entlegensten Drittel liegt. An den Epimeren dagegen
rücken die Sphäritenzentren der Crista-Randstruktur dicht an der Kante der Crista hinauf, so daß
die Zentren der gegenüberliegenden Sphäriten sich einander auf der Kante fast berühren.
Ich glaube nun, daß die Entstehung dieser Randstruktur auf die Bewegungsmechanik des Tieres
zurückzuführen ist; In der Mineralogie kennt man sog. O r th o tro p ie (cf. R in n e , Z s. f. Kristallogr.
LXIV. 1926. p. 71 etc.), d. h. die Erscheinung, daß die Kristalle unter dem Einfluß äußerer Kräfte
eine gesetzmäßige Orientierung annehmen. Ich vermute, daß wir hier mit einer analogen Erscheinung
zu tu n haben. Als „äußere Kräfte“ würden hier der Zug und Druck, welche bei den Bewegungen
des Rumpfes Zustandekommen, fungieren. Bei der Kontraktion der ventralen Flexoren (cf. D e l l a
V a l l e , p. 83—86, Taf. 43 Fig. 2), d. h. bei der ventral gerichteten Krümmung des Hinterkörpers,
sind die Segmenthinterränder einem Zug, bei der Kontraktion der dorsalen Extensoren, d. h. bei
einer Streckung des Körpers, einem Druck ausgesetzt. In der Richtung des Zuges, bezw. Druckes
sind die Sphäriten, bezw. ihre Komponenten, die Fasern gestreckt, und das Zentrum — dem morphologischen
Bilde nach p§- in entgegengesetzter Richtung, also bei den Tergiten oral, verlagert.
Nach dieser Auffassung ist der obenerwähnte Unterschied der beiden Randstrukturen leicht verständlich.
Der Unterschied ist nämlich nur ein scheinbarer, weil die Sphäriten der Crista ebenfalls
dem oben erörterten Prinzip gehorchen1).
Mutatis mutandis kann man diese Erklärung auch auf die Randstruktur der Tanaidaceen, Cera-
tothoa-hai'ven und der Oniscoiden anwenden und es ist nicht ausgeschlossen, daß w ir h ie r m it
e in e r s t a t i s c h - f u n k t io n e l l e n S t r u k t u r im S in n e v o n Roux zu tu n h a b e n . Zwecks
x) Ähnliche Erscheinungen haben wir beim Hexapleomera Schmidli in den sog. Plättchenstreifen kennen gelernt.