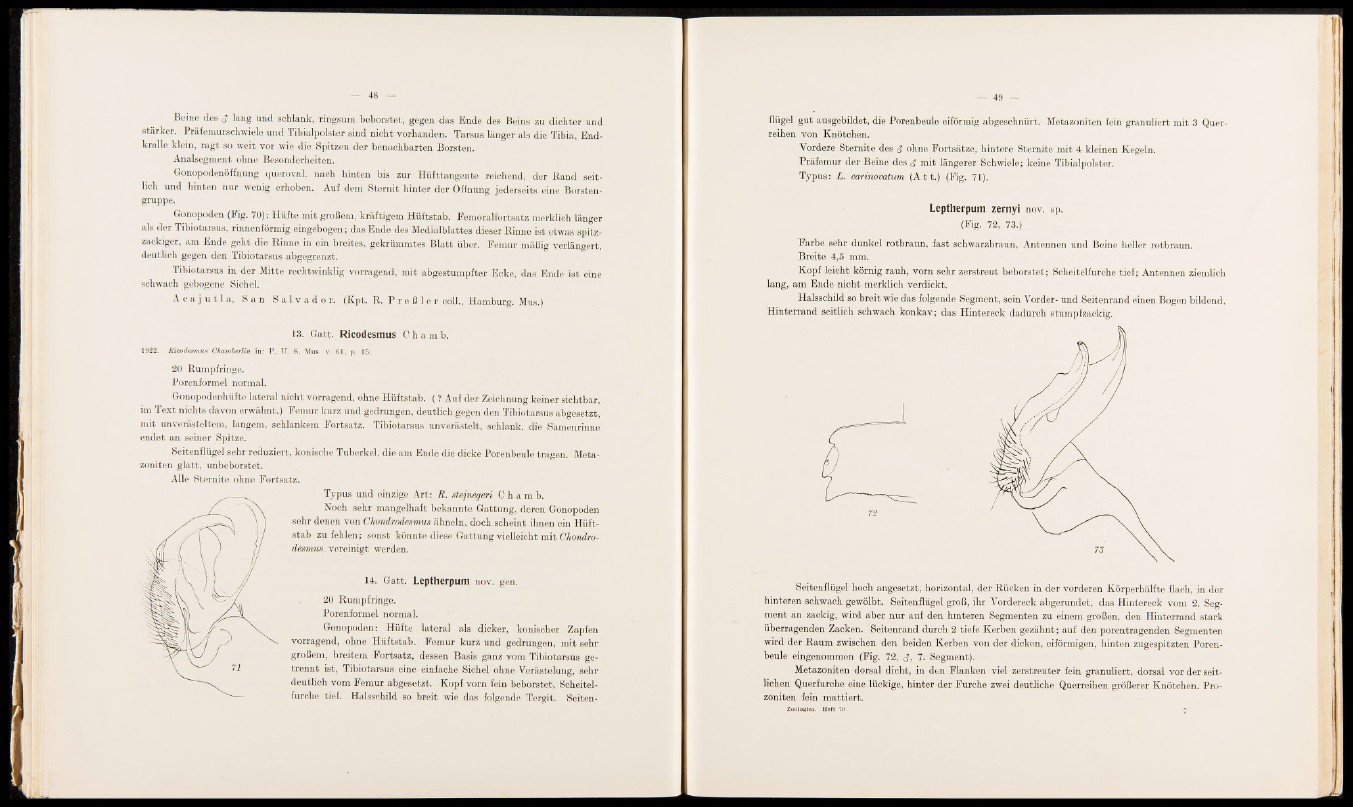
Beine deB <J lang und schlank, ringsum behorstet, gegen das Ende des Beins zu dichter und
starker. Präfemurschwiele und Tibialpolster sind nicht vorhanden. Tarsus länger als die Tibia, Endkralle
klein, ragt so weit vor wie die Spitzen der benachbarten Borsten.
Analsegment ohne Besonderheiten.
Gonopodenöffnung queroval, nach hinten bis zur Hüfttangente reichend, der Band seitlich
und hinten nur wenig erhoben. Auf dem Sternit hinter der Öffnung jederseits eine Borsten-
gruppe.
Gonopoden (Fig. 70): Hüfte mit großem, kräftigem Hüftstab. Femoralfortsatz merklich länger
als der Tibiotarsus, rinnenförmig eingebogen; das Ende des Medialblattes dieser Rinne ist etwas spitzzackiger,
am Ende geht die Binne in ein breites, gekrümmtes Blatt über. Femur mäßig verlängert,
deutlich gegen den Tibiotarsus abgegrenzt.
Tibiotarsus in der Mitte rechtwinklig vorragend, mit abgestumpfter Ecke, das Ende ist eine
schwach gebogene Sichel.
A c a j u t l a , S a n S a l v a d o r , (Kpt. B. P r e ß 1 e r coll., Hamburg. Mus.)
13. Gatt. Ricodesmus C h a m b.
1922. Ricodesmus Ohamberlin in: P. U. S. Mus. v. 61. p. 15.
20 Rumpfringe.
Porenformel normal.
Gonopodenhüfte lateral nicht vorragend, ohne Hüftstab. (? Auf der Zeichnung keiner sichtbar,
im Text nichts davon erwähnt.) Femur kurz und gedrungen, deutlich gegen den Tibiotarsus abgesetzt,
mit unverästeltem, langem, schlankem Fortsatz. Tibiotarsus unverästelt, schlank, die Samenrinne
endet an seiner Spitze.
Seitenflügel sehr reduziert, konische Tuberkel, die am Ende die dicke Porenbeule tragen. Meta-
zoniten glatt, unbeborstet.
Alle Sternite ohne Fortsatz.
Typus und einzige Art: R. stejnegeri C h a m b.
Noch sehr mangelhaft bekannte Gattung, deren Gonopoden
sehr denen von Chondrodesmus ähneln, doch scheint ihnen ein Hüftstab
zu fehlen; sonst könnte diese Gattung vielleicht mit Chondrodesmus.
vereinigt werden.
14. Gatt. Leptherpum nov. gen.
20 Rumpfringe.
Porenformel normal.
Gonopoden: Hüfte lateral als dicker, konischer Zapfen
vorragend, ohne Hüftstab. Femur kurz und gedrungen, mit sehr
großem, breitem Fortsatz, dessen Basis ganz vom Tibiotarsus getrennt
ist, Tibiotarsus eine einfache Sichel ohne Verästelung, sehr
deutlich vom Femur abgesetzt. Kopf vorn fein beborstet, Scheitelfurche
tief. Halsschild so breit wie das folgende Tergit. Seitenflügel
gut ausgebildet, die Porenbeule eiförmig abgeschnürt. Metazoniten fein granuliert mit 3 Querreihen
von Knötchen.
Vordere Sternite des $ ohne Fortsätze, hintere Sternite mit 4 kleinen Kegeln.
Präfemur der Beine des $ mit längerer Schwiele; keine Tibialpolster.
Typus: L. carinovatum (A tt.) (Fig. 71).
Leptherpum zernyi nov. sp.
(Fig. 72, 73.)
Farbe sehr dunkel rotbraun, fast schwarzbraun, Antennen und Beine heller rotbraun.
Breite 4,5 mm.
Kopf leicht körnig rauh, vorn sehr zerstreut beborstet; Scheitelfurche tief; Antennen ziemlich
lang, am Ende nicht merklich verdickt.
Halsschild so breit wie das folgende Segment, sein Vorder- und Seitenrand einen Bogen bildend,
Hinterrand seitlich schwach konkav; das Hintereck dadurch stumpfzackig.
Seitenflügel hoch angesetzt, horizontal, der Rücken in der vorderen Körperhälfte flach, in der
hinteren schwach gewölbt. Seitenflügel groß, ihr Vordereck abgerundet, das Hintereck vom 2. Segment
an zackig, wird aber nur auf den hinteren Segmenten zu einem großen, den Hinterrand stark-
überragenden Zacken. Seitenrand durch 2 tiefe Kerben gezähnt; auf den porentragenden Segmenten
wird der Raum zwischen den beiden Kerben von der dicken, eiförmigen, hinten zugespitzten Porenbeule
eingenommen (Fig. 72, <?, 7. Segment).
Metazoniten dorsal dicht, in den Flanken viel zerstreuter fein granuliert, dorsal vor der seitlichen
Querfurche eine lückige, hinter der Furche zwei deutliche Querreihen größerer Knötchen. Pro-
zoniten fein mattiert.
Zoologica. Heft 79. n