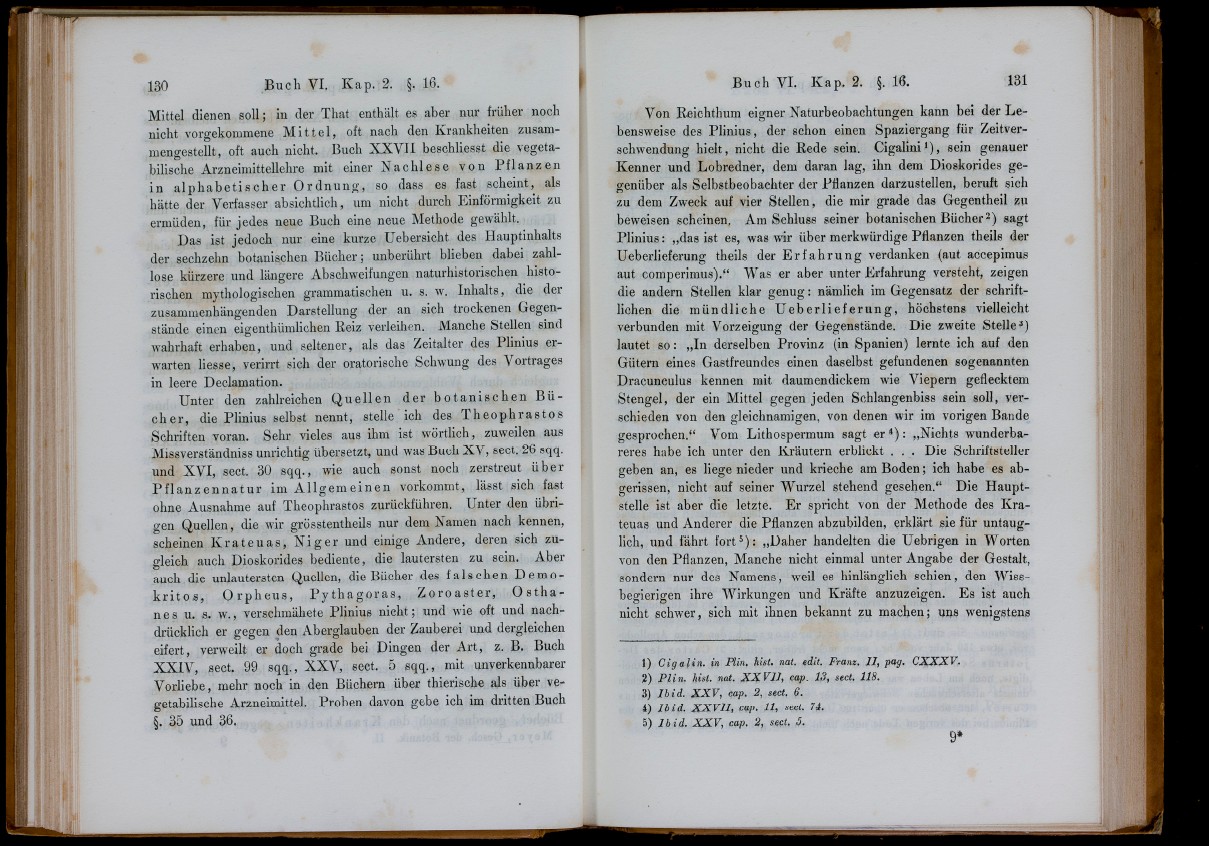
uf ti
J
I• {
130 Buch VI. Kap. 2. §. 16.
Mittel dienen soll; in der That enthält es aber nur früher noch
nicht vorgekommene Mittel, oft nach den Krankheiten zusammengestellt,
oft auch nicht. Buch XXVI I beschliesst die vegetabilische
Arzneimittellehre mit einer Nachlese von Pflanzen
in alphabetischer Ordnung, so dass es fast scheint, als
hätte der Verfasser absichtlich, um nicht durch Einförmigkeit zu
ermüden, für jedes neue Buch eine neue Methode gewählt.
Das ist jedoch nur eine kurze Uebersicht des Hauptinhalts
der sechzehn botanischen Bücher; unberührt blieben dabei zahllose
kürzere und längere Abschweifungen naturhistorischen historischen
mythologischen grammatischen u. s. w. Inhahs, die der
zusammenhängenden Darstellung der an sich trockenen Gegenstände
einen eigenthümlichen Reiz verleihen. Manche Stellen sind
wahrhaft erhaben, und seltener, als das Zeitalter des Plinius erwarten
Hesse, verirrt sich der oratorische Schwung des Vortrages
in leere Declamation.
Unter den zahlreichen Quellen der botanischen Büc
h e r , die Plinius selbst nennt, stelle ich des Theophrastos
Schriften voran. Sehr vieles aus ihm ist wörtHch, zuweilen aus
Missverständniss unrichtig übersetzt, und was Buch XV, sect. 26 sqq.
und XVI, sect. 30 sqq., wie auch sonst noch zerstreut über
P f l a n z e n n a t u r im Al lgemeinen vorkommt, lässt sich fast
ohne Ausnahme auf Theophrastos zurückführen. Unter den übrigen
Quellen, die wir grösstentheils nur dem Namen nach kennen,
scheinen Krateuas , Niger und einige Andere, deren sich zugleich
auch Dioskorides bediente, die lautersten zu sein. Aber
auch die unlautersten Quellen, die Bücher des falschen Demok
r i t o s , Orpheus, Pythagoras, Zoroaster, Osthanes
u. s. w., verschmähete Plinius nicht; und wie oft und nachdrückhch
er gegen den Aberglauben der Zauberei und dergleichen
eifert, verweilt er doch grade bei Dingen der Art, z. B. Buch
X X I V , sect. 99 sqq., XXV, sect. 5 sqq., mit unverkennbarer
Vorhebe, mehr noch in den Büchern über thierische als über vegetabilische
Arzneimittel. Proben davon gebe ich im dritten Buch
S. 35 und 36.
Buch VI. Kap. 2. §. 16. 131
Von Reichthum eigner Naturbeobachtungen kann bei der Lebensweise
des Plinius, der schon einen Spaziergang für Zeitverschwendung
hielt, nicht die Rede sein. Cigalinii), ggin genauer
Kenner und Lobredner, dem daran lag, ihn dem Dioskorides gegenüber
als Selbstbeobachter der Pflanzen darzustellen, beruft sich
zu dem Zweck auf vier Stellen, die mir grade das Gegentheil zu
beweisen scheinen, Am Schluss seiner botanischen Bücher 2) sagt
Plinius: „das ist es, was wir über merkwürdige Pflanzen theils der
Ueberlieferung theils der E r fahrung verdanken (aut accepimus
aut comperimus)." Was er aber unter Erfahrung versteht, zeigen
die andern Stellen klar genug: nämlich im Gegensatz der schriftlichen
die mündliche Ueb e r l ief e rung , höchstens vielleicht
verbunden mit Vorzeigung der Gegenstände. Die zweite Stelle 3)
lautet so: „In derselben Provinz (in Spanien) lernte ich auf den
Gütern eines Gastfreundes einen daselbst gefundenen sogenannten
Dracunculus kennen mit daumendickem wie Viepern geflecktem
Stengel, der ein Mittel gegen jeden Schlangenbiss sein soll, verschieden
von den gleichnamigen, von denen wir im vorigen Bande
gesprochen." Vom Lithospermum sagt er : „Nichts wunderbareres
habe ich unter den Kräutern erblickt . , . Die Schriftsteller
geben an, es liege nieder und krieche am Boden; ich habe es abgerissen,
nicht auf seiner Wurzel stehend gesehen." Die Hauptstelle
ist aber die letzte. Er spricht von der Methode des Krateuas
und Anderer die Pflanzen abzubilden, erklärt sie für untauglich,
und fährt fort^): „Daher handelten die Uebrigen in Worten
von den Pflanzen, Manche nicht einmal unter Angabe der Gestalt,
sondern nur des Namens, weil es hinlänglich schien, den Wissbegierigen
ihre Wirkungen und Kräfte anzuzeigen. Es ist auch
nicht schwer, sich mit ihnen bekannt zu machen; uns wenigstens
1) Cigalin. in Plin. Mst. nat. edit. Franz. II, pug. CXXXV.
2) Plin. hist. nat. XXVIl, cap. 13, sect. 118.
3) Ihid. XXV, cap. 2, sect. 6.
4) Ibid. XXVII, cap. 11, sect. 74.
5) Ibid. XXV, cap. 2, sect. ö.