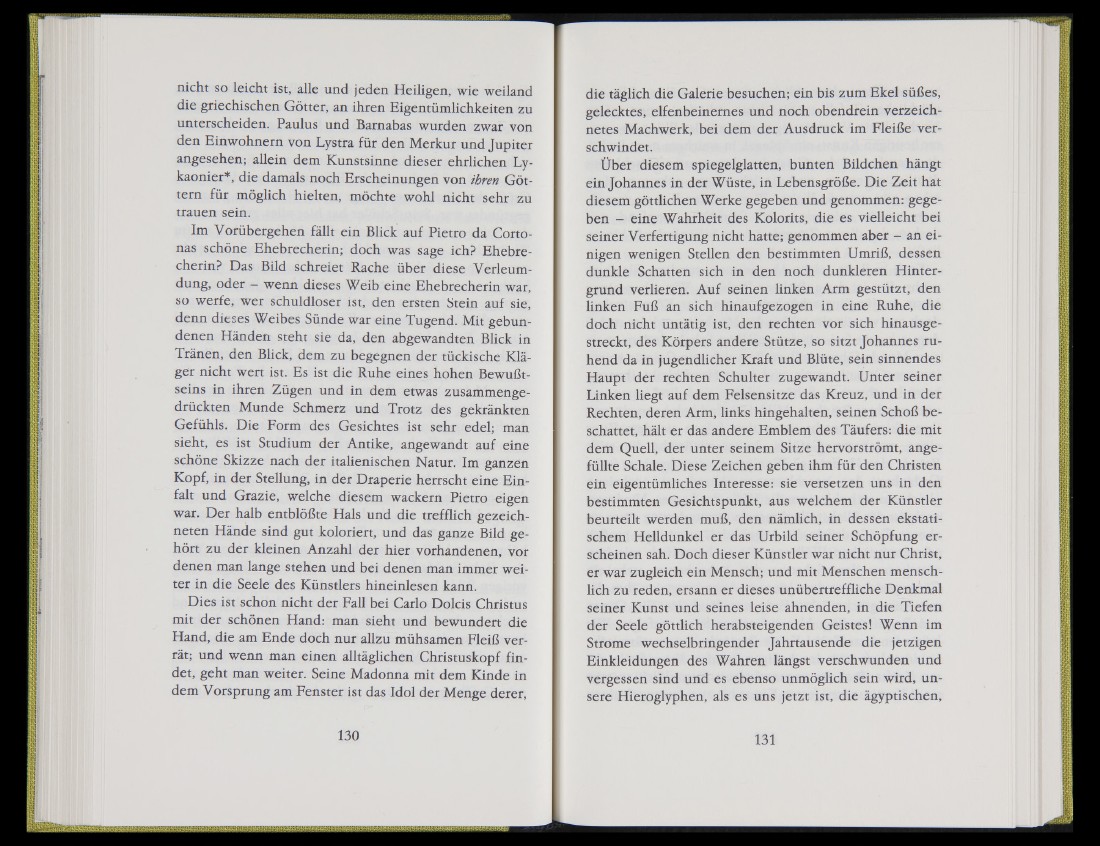
nicht so leicht ist, alle und jeden Heiligen, wie weiland
die griechischen Götter, an ihren Eigentümlichkeiten zu
unterscheiden. Paulus und Barnabas wurden zwar von
den Einwohnern von Lystra für den Merkur und Jupiter
angesehen; allein dem Kunstsinne dieser ehrlichen Ly-
kaonier*, die damals noch Erscheinungen von ihren Göttern
für möglich hielten, möchte wohl nicht sehr zu
trauen sein.
Im Vorübergehen fällt ein Blick auf Pietro da Corto-
nas schöne Ehebrecherin; doch was sage ich? Ehebrecherin?
Das Bild schreiet Rache über diese Verleumdung,
oder - wenn dieses Weib eine Ehebrecherin war,
so werfe, wer schuldloser ist, den ersten Stein auf sie,
denn dieses Weibes Sünde war eine Tugend. Mit gebundenen
Händen steht sie da, den abgewandten Blick in
Tränen, den Blick, dem zu begegnen der tückische Kläger
nicht wert ist. Es ist die Ruhe eines hohen Bewußtseins
in ihren Zügen und in dem etwas zusammengedrückten
Munde Schmerz und Trotz des gekränkten
Gefühls. Die Form des Gesichtes ist sehr edel; man
sieht, es ist Studium der Antike, angewandt auf eine
schöne Skizze nach der italienischen Natur. Im ganzen
Kopf, in der Stellung, in der Draperie herrscht eine Einfalt
und Grazie, welche diesem wackern Pietro eigen
war. Der halb entblößte Hals und die trefflich gezeichneten
Hände sind gut koloriert, und das ganze Bild gehört
zu der kleinen Anzahl der hier vorhandenen, vor
denen man lange stehen und bei denen man immer weiter
in die Seele des Künstlers hineinlesen kann.
Dies ist schon nicht der Fall bei Carlo Dolcis Christus
mit der schönen Hand: man sieht und bewundert die
Hand, die am Ende doch nur allzu mühsamen Fleiß verrät;
und wenn man einen alltäglichen Christuskopf findet,
geht man weiter. Seine Madonna mit dem Kinde in
dem Vorsprung am Fenster ist das Idol der Menge derer,
die täglich die Galerie besuchen; ein bis zum Ekel süßes,
gelecktes, elfenbeinernes und noch obendrein verzeich-
netes Machwerk, bei dem der Ausdruck im Fleiße verschwindet.
Über diesem spiegelglatten, bunten Bildchen hängt
ein Johannes in der Wüste, in Lebensgröße. Die Zeit hat
diesem göttlichen Werke gegeben und genommen: gegeben
- eine Wahrheit des Kolorits, die es vielleicht bei
seiner Verfertigung nicht hatte; genommen aber - an einigen
wenigen Stellen den bestimmten Umriß, dessen
dunkle Schatten sich in den noch dunkleren Hintergrund
verlieren. Auf seinen linken Arm gestützt, den
linken Fuß an sich hinaufgezogen in eine Ruhe, die
doch nicht untätig ist, den rechten vor sich hinausgestreckt,
des Körpers andere Stütze, so sitzt Johannes ruhend
da in jugendlicher Kraft und Blüte, sein sinnendes
Haupt der rechten Schulter zugewandt. Unter seiner
Linken liegt auf dem Felsensitze das Kreuz, und in der
Rechten, deren Arm, links hingehalten, seinen Schoß beschattet,
hält er das andere Emblem des Täufers: die mit
dem Quell, der unter seinem Sitze hervorströmt, angefüllte
Schale. Diese Zeichen geben ihm für den Christen
ein eigentümliches Interesse: sie versetzen uns in den
bestimmten Gesichtspunkt, aus welchem der Künstler
beurteilt werden muß, den nämlich, in dessen ekstatischem
Helldunkel er das Urbild seiner Schöpfung erscheinen
sah. Doch dieser Künstler war nicht nur Christ,
er war zugleich ein Mensch; und mit Menschen menschlich
zu reden, ersann er dieses unübertreffliche Denkmal
seiner Kunst und seines leise ahnenden, in die Tiefen
der Seele göttlich herabsteigenden Geistes! Wenn im
Strome wechselbringender Jahrtausende die jetzigen
Einkleidungen des Wahren längst verschwunden und
vergessen sind und es ebenso unmöglich sein wird, unsere
Hieroglyphen, als es uns jetzt ist, die ägyptischen,