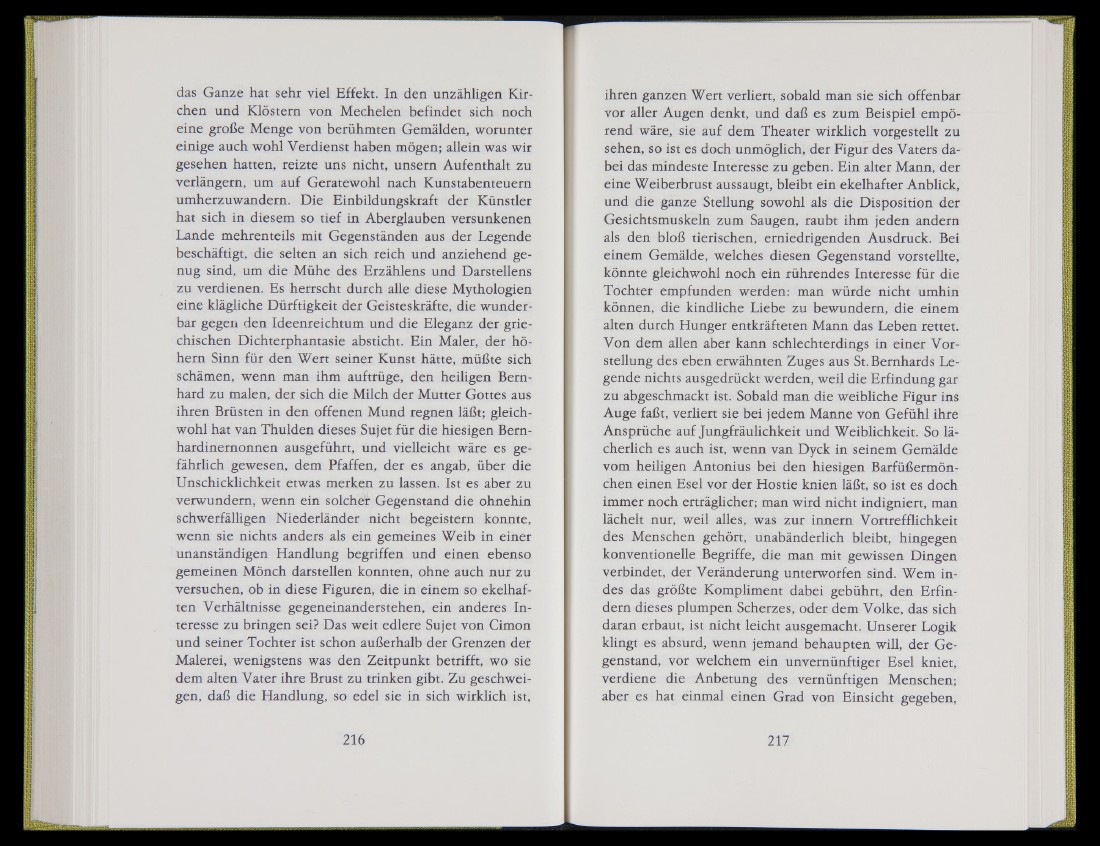
das Ganze hat sehr viel Effekt. In den unzähligen Kirchen
und Klöstern von Mechelen befindet sich noch
eine große Menge von berühmten Gemälden, worunter
einige auch wohl Verdienst haben mögen; allein was wir
gesehen hatten, reizte uns nicht, unsern Aufenthalt zu
verlängern, um auf Geratewohl nach Kunstabenteuern
umherzuwandern. Die Einbildungskraft der Künstler
hat sich in diesem so tief in Aberglauben versunkenen
Lande mehrenteils mit Gegenständen aus der Legende
beschäftigt, die selten an sich reich und anziehend genug
sind, um die Mühe des Erzählens und Darstellens
zu verdienen. Es herrscht durch alle diese Mythologien
eine klägliche Dürftigkeit der Geisteskräfte, die wunderbar
gegen den Ideenreichtum und die Eleganz der griechischen
Dichterphantasie absticht. Ein Maler, der hohem
Sinn für den Wert seiner Kunst hätte, müßte sich
schämen, wenn man ihm auftrüge, den heiligen Bernhard
zu malen, der sich die Milch der Mutter Gottes aus
ihren Brüsten in den offenen Mund regnen läßt; gleichwohl
hat van Thulden dieses Sujet für die hiesigen Bernhardinernonnen
ausgeführt, und vielleicht wäre es gefährlich
gewesen, dem Pfaffen, der es angab, über die
Unschicklichkeit etwas merken zu lassen. Ist es aber zu
verwundern, wenn ein solcher Gegenstand die ohnehin
schwerfälligen Niederländer nicht begeistern konnte,
wenn sie nichts anders als ein gemeines Weib in einer
unanständigen Handlung begriffen und einen ebenso
gemeinen Mönch darstellen konnten, ohne auch nur zu
versuchen, ob in diese Figuren, die in einem so ekelhaften
Verhältnisse gegeneinanderstehen, ein anderes Interesse
zu bringen sei? Das weit edlere Sujet von Cimon
und seiner Tochter ist schon außerhalb der Grenzen der
Malerei, wenigstens was den Zeitpunkt betrifft, wo sie
dem alten Vater ihre Brust zu trinken gibt. Zu geschwei-
gen, daß die Handlung, so edel sie in sich wirklich ist,
ihren ganzen Wert verliert, sobald man sie sich offenbar
vor aller Augen denkt, und daß es zum Beispiel empörend
wäre, sie auf dem Theater wirklich vorgestellt zu
sehen, so ist es doch unmöglich, der Figur des Vaters dabei
das mindeste Interesse zu geben. Ein alter Mann, der
eine Weiberbrust aussaugt, bleibt ein ekelhafter Anblick,
und die ganze Stellung sowohl als die Disposition der
Gesichtsmuskeln zum Saugen, raubt ihm jeden ändern
als den bloß tierischen, erniedrigenden Ausdruck. Bei
einem Gemälde, welches diesen Gegenstand vorstellte,
könnte gleichwohl noch ein rührendes Interesse für die
Tochter empfunden werden: man würde nicht umhin
können, die kindliche Liebe zu bewundern, die einem
alten durch Hunger entkräfteten Mann das Leben rettet.
Von dem allen aber kann schlechterdings in einer Vorstellung
des eben erwähnten Zuges aus St. Bernhards Legende
nichts ausgedrückt werden, weil die Erfindung gar
zu abgeschmackt ist. Sobald man die weibliche Figur ins
Auge faßt, verliert sie bei jedem Manne von Gefühl ihre
Ansprüche auf Jungfräulichkeit und Weiblichkeit. So lächerlich
es auch ist, wenn van Dyck in seinem Gemälde
vom heiligen Antonius bei den hiesigen Barfüßermönchen
einen Esel vor der Hostie knien läßt, so ist es doch
immer noch erträglicher; man wird nicht indigniert, man
lächelt nur, weil alles, was zur innern Vortrefflichkeit
des Menschen gehört, unabänderlich bleibt, hingegen
konventionelle Begriffe, die man mit gewissen Dingen
verbindet, der Veränderung unterworfen sind. Wem indes
das größte Kompliment dabei gebührt, den Erfindern
dieses plumpen Scherzes, oder dem Volke, das sich
daran erbaut, ist nicht leicht ausgemacht. Unserer Logik
klingt es absurd, wenn jemand behaupten will, der Gegenstand,
vor welchem ein unvernünftiger Esel kniet,
verdiene die Anbetung des vernünftigen Menschen;
aber es hat einmal einen Grad von Einsicht gegeben,