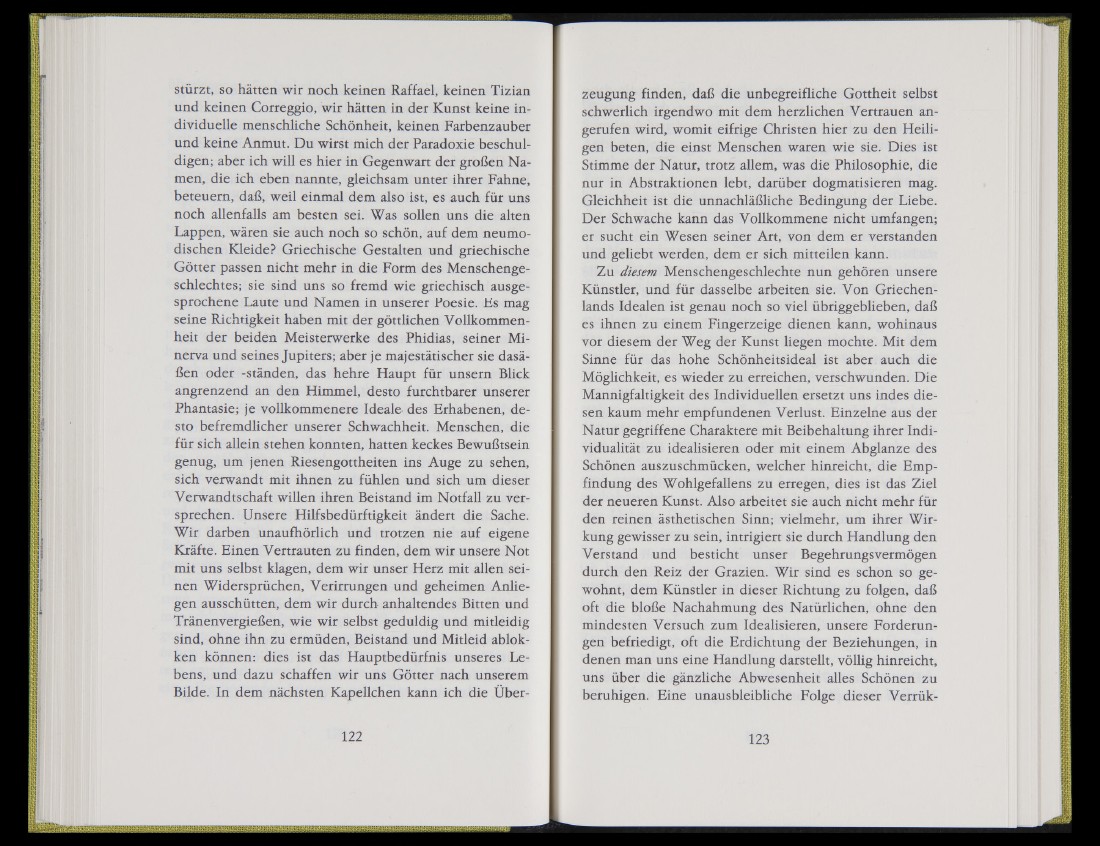
stürzt, so hätten wir noch keinen Raffael, keinen Tizian
und keinen Correggio, wir hätten in der Kunst keine individuelle
menschliche Schönheit, keinen Farbenzauber
und keine Anmut. Du wirst mich der Paradoxie beschuldigen;
aber ich will es hier in Gegenwart der großen Namen,
die ich eben nannte, gleichsam unter ihrer Fahne,
beteuern, daß, weil einmal dem also ist, es auch für uns
noch allenfalls am besten sei. Was sollen uns die alten
Lappen, wären sie auch noch so schön, auf dem neumodischen
Kleide? Griechische Gestalten und griechische
Götter passen nicht mehr in die Form des Menschengeschlechtes;
sie sind uns so fremd wie griechisch ausgesprochene
Laute und Namen in unserer Poesie. Es mag
seine Richtigkeit haben mit der göttlichen Vollkommenheit
der beiden Meisterwerke des Phidias, seiner Minerva
und seines Jupiters; aber je majestätischer sie dasäßen
oder -ständen, das hehre Haupt für unsern Blick
angrenzend an den Himmel, desto furchtbarer unserer
Phantasie; je vollkommenere Ideale- des Erhabenen, desto
befremdlicher unserer Schwachheit. Menschen, die
für sich allein stehen konnten, hatten keckes Bewußtsein
genug, um jenen Riesengottheiten ins Auge zu sehen,
sich verwandt mit ihnen zu fühlen und sich um dieser
Verwandtschaft willen ihren Beistand im Notfall zu versprechen.
Unsere Hilfsbedürftigkeit ändert die Sache.
Wir darben unaufhörlich und trotzen nie auf eigene
Kräfte. Einen Vertrauten zu finden, dem wir unsere Not
mit uns selbst klagen, dem wir unser Herz mit allen seinen
Widersprüchen, Verirrungen und geheimen Anliegen
ausschütten, dem wir durch anhaltendes Bitten und
Tränen vergießen, wie wir selbst geduldig und mitleidig
sind, ohne ihn zu ermüden, Beistand und Mitleid ablok-
ken können: dies ist das Hauptbedürfnis unseres Lebens,
und dazu schaffen wir uns Götter nach unserem
Bilde. In dem nächsten Kapellchen kann ich die Überzeugung
finden, daß die unbegreifliche Gottheit selbst
schwerlich irgendwo mit dem herzlichen Vertrauen angerufen
wird, womit eifrige Christen hier zu den Heiligen
beten, die einst Menschen waren wie sie. Dies ist
Stimme der Natur, trotz allem, was die Philosophie, die
nur in Abstraktionen lebt, darüber dogmatisieren mag.
Gleichheit ist die unnachläßliche Bedingung der Liebe.
Der Schwache kann das Vollkommene nicht umfangen;
er sucht ein Wesen seiner Art, von dem er verstanden
und geliebt werden, dem er sich mitteilen kann.
Zu diesem Menschengeschlechte nun gehören unsere
Künstler, und für dasselbe arbeiten sie. Von Griechenlands
Idealen ist genau noch so viel übriggeblieben, daß
es ihnen zu einem Fingerzeige dienen kann, wohinaus
vor diesem der Weg der Kunst liegen mochte. Mit dem
Sinne für das hohe Schönheitsideal ist aber auch die
Möglichkeit, es wieder zu erreichen, verschwunden. Die
Mannigfaltigkeit des Individuellen ersetzt uns indes diesen
kaum mehr empfundenen Verlust. Einzelne aus der
Natur gegriffene Charaktere mit Beibehaltung ihrer Individualität
zu idealisieren oder mit einem Abglanze des
Schönen auszuschmücken, welcher hinreicht, die Empfindung
des Wohlgefallens zu erregen, dies ist das Ziel
der neueren Kunst. Also arbeitet sie auch nicht mehr für
den reinen ästhetischen Sinn; vielmehr, um ihrer Wirkung
gewisser zu sein, intrigiert sie durch Handlung den
Verstand und besticht unser Begehrungs vermögen
durch den Reiz der Grazien. Wir sind es schon so gewohnt,
dem Künstler in dieser Richtung zu folgen, daß
oft die bloße Nachahmung des Natürlichen, ohne den
mindesten Versuch zum Idealisieren, unsere Forderungen
befriedigt, oft die Erdichtung der Beziehungen, in
denen man uns eine Handlung darstellt, völlig hinreicht,
uns über die gänzliche Abwesenheit alles Schönen zu
beruhigen. Eine unausbleibliche Folge dieser Verrük