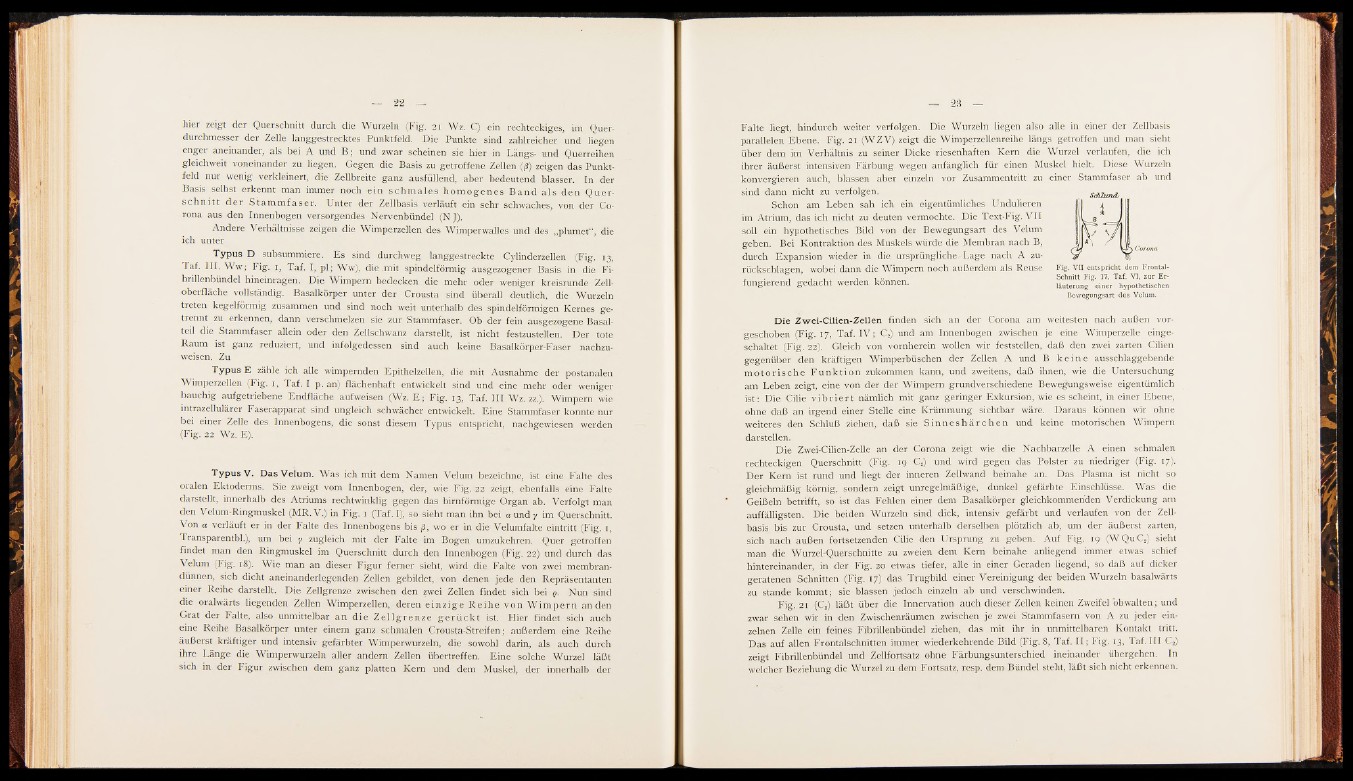
hier zeigt der Querschnitt durch die Wurzeln |j|g. 21 Wz. '■ ein rechteckiges,: im Querdurchmesser
der Zelle langgestrecktes Punktfeld. Die Punkte sind zahlreicher, und liegen
enger aneinander, als bei A und B ; und zwar scheinen -sic hier in Längs* und Querreihen
gleichweit voneinander zu liegen. Segen die Basis zu getroffene Zellen (ß) zeigen das Punktfeld
nur wenig verkleinert* die Zellbreite ganz ausfüllend, aber bedeutendKlasser. In der
Basis selbst erkennt .man immer nochBin ■sschmales homogenes Band als den Quersch
n itt der S tam m fa^ r . iUnter der Zellbasis verläuft ein. sehr schwache^von der Corona
aus den Innenbogen versorgendes Nervenbündel
Andere Verhältnisse zeigen die Wimperzellen des Wimpcrwalles und des „plumet", die.
ich unter
Typus D subsummiere. Ks sind durchweg langgestreckt4i|%lindetzellen (Fig. 13,
Taf. III. Ww; Fig.. i, Taf. I, pl; Ww), di^rnit spindelförmig ausgezogener Basis in die Fibrillenbündel
hineinragen. Die Wimpern bedeckeh^die mehr oder weniger kreisrunde Z<äL
Oberfläche vollständig. Basalkörper unter der Crousta Sind überall deutlich, die Wurzeln
treten kegelförmig zusammen und sind epch weit unterhalb <jgs<Spindelförmigen Kernes getrennt
zu erkennen, dann verschmelzen sie zur Stammfaser, Qb der 'fSin ausgezbien^pasal-
teü die Stammfaser allein oder den Zellschwanz darstellt, rät n ic j l festzustellen. Der to t j
Raum ist ganz reduziert, und infolgede^^n sind auch keine Basalkörper-llllser nachzuweisen.
Zu
Typus E zähle ich alle wimpernden Epithelzellen, die mit Ausnahme der postanalen
Wimperzellen (Fig. i, Taf. I p. an) flächenhaft entwickelt sind und eine mehr oder weniger
bauchig auf getriebene Endfläche aufweisen (Wz. E; Fig. 13, Taf. III Wz. zz.). Wimpern wie
intrazellulärer Faserapparat sind ungleich schwächer entwickelt. Eine Stammfaser konnte nur
bei einer Zelle des Innenbogens, die sonst diesem Typus entspricht, nachgewiesen werden
(Fig. 22 Wz. E).
Typus V. DasVelum. Was ich mit dem Namen Velum bezeichne, ist eine Falte des
oralen Ektoderms. Sie zweigt vom Innenbogen, der, wie Fig. .22 zeigt, ebenfalls eine Falte
darstellt, innerhalb des Atriums rechtwinklig gegen das bimförmige Organ ab. Verfolgt man
den Velum-Ringmuskel (MR. V.) in Fig. 1 (Taf. I), so sieht man ihn bei a und y im Querschnitt.
Von a verläuft er in der Falte des Innenbogens bis ß, wo er in die Velumfalte eintritt (Fig. 1,
Transparentbl.), um bei y zugleich mit der Falte im Bogen umzukehren. Quer getroffen
findet man den Ringmuskel im Querschnitt durch den Innenbogen (Fig. 22) und durch das
Velum (Fig. 18). Wie man an dieser Figur ferner sieht, wird die Falte von zwei membrandünnen,
sich dicht aneinanderlegenden Zellen gebildet, von denen jede den Repräsentanten
einer Reihe darstellt. Die Zellgrenze zwischen den zwei Zellen findet sich bei Nun Sind
die oralwärts liegenden Zellen Wimperzellen, deren e in z ig e R e ih e von Wimpern an den
Grat der Falte, also unmittelbar an die Z e jlg ren z e g e rü ck t ist. Hier findet sich auch
eine Reihe Basalkörper unter einem ganz schmalen Crousta-Streifen; außerdem eine Reihe
äußerst kräftiger und intensiv gefärbter Wimperwurzeln, die sowohl darin, als auch durch
ihre Länge die Wimperwurzeln aller ändern Zellen übertreffen. Eine solche Wurzel läßt
sich in. der Figur zwischen dem ganz platten Kern und dem Muskel, der innerhalb der
Falte liegt, hindurch weiter verfolgen. Die Wurzeln liegen also alle in einer der Zellbasis
parallelen Ebene. Fig. 21 (WZV) zeigt die Wimperzellenreihe längs getroffen und man sieht
über dem im Verhältnis zu seiner Dicke riesenhaften Kern die Wurzel verlaufen, die ich
ihrer äußerst intensiven Färbung wegen anfänglich für einen Muskel hielt. Diese Wurzeln
konvergieren auch, blassen aber einzeln vor Zusammentritt zu einer Stammfaser ab und
sind dann nicht zu verfolgen.
Schon am Leben sah ich ein eigentümliches Undulieren
im Atrium, das ich nicht zu deuten vermochte. Die Text-Fig. VII
soll ein hypothetisches Bild von der Bewegungsart des Velum
geben. Bei Kontraktion des Muskels würde die Membran nach B,
durch Expansion wieder in die ursprüngliche^ Lage nach A Z u rückschlagen,
wobei dann die Wimpern noch außerdem als Reuse
fungierend gedacht werden können.
SmZuruL
F ig. VII entspricht dem Frontal-
Schnitt Fig. 17, T a f. VI, zur E rläuterung
einer hypothetischen
Bewegungsart des Velum.
Die Zwei-Cilien-Zellen finden sich an der Corona am weitesten nacn auDen vorgeschoben
(Fig. 17, Taf. IV; C2) und am Innenbogen zwischen je eine Wimperzelle eingeschaltet
(Fig. 22). Gleich von vornherein wollen wir feststellen, daß den zwei zarten Cilien
gegenüber den kräftigen Wimperbüschen der Zellen A und B k e in e ausschlaggebende
mo to risch e F unktion zukommen kann, und zweitens, daß ihnen, wie die H Q ntersuchung
am Leben zeigt, eine von der der Wimpern grundverschiedene Bewegungsweise eigentümlich
ist: Die Cilie v ib r ie r t nämlich mit ganz geringer Exkursion, wie es scheint, in einer Ebene,
ohne daß an irgend einer Stelle eine Krümmung sichtbar wäre. Daraus können wir ohne
weiteres den Schluß ziehen, daß sie S in n e sh ä r ch en und keine motorischen Wimpern
darstellen.
Die Zwei-Cilien-Zelle an der Corona zeigt' wie die Nachbarzelle A einen schmalen
rechteckigen Querschnitt (Fig.|i|9 C2) und wird gegen das Polster zu niedriger (Fig. 17).
Der Kern ist rund und liegt der inneren Zellwand beinahe an. Das Plasma ist nicht so
gleichmäßig körnig, sondern zeigt unregelmäßige, dunkel gefärbte Einschlüsse. Was die
Geißeln betrifft, so ist das Fehlen einer dem Basalkörper gleichkommenden Verdickung am
auffälligsten. Die beiden Wurzeln sind dick, intensiv gefärbt und verlaufen von der Zellbasis
ljis zur Crousta, und setzen unterhalb derselben plötzlich ab, um der äußerst zarten,
sich nach außen fortsetzenden Cilie den Ursprung zu geben. Auf Fig. 19 (WQuC2) sieht
man die Wurzel-Querschnitte zu zweien dem Kern beinahe anliegend immer etwas schief
hintereinander, in der Fig. 20 etwas tiefer, alle in einer Geraden liegend, so daß auf dicker
geratenen Schnitten (Fig. 17) das Trugbild einer Vereinigung der beiden Wurzeln basalwärts
zu Stande kommt; sie blassen jedoch einzeln ab und verschwinden.
Fig. 21 (C2) läßt über die Innervation auch dieser Zellen keinen Zweifel obwalten; und
zwar sehen wir in den Zwischenräumen zwischen je zwei Stammfasern von A zu jeder einzelnen
Zelle ein feines Fibrillenbündel ziehen, das mit ihr in unmittelbaren Kontakt tritt.
Das auf allen Frontalschnitten immer wiederkehrende Bild (Fig. 8, Taf. II; Fig. 13, Taf. III C2)
zeigt Fibrillenbündel und Zellfortsatz ohne Färbungsunterschied ineinander übergehen. In
welcher Beziehung die Wurzel zu dem Fortsatz, resp. dem Bündel steht, läßt sich nicht erkennen.