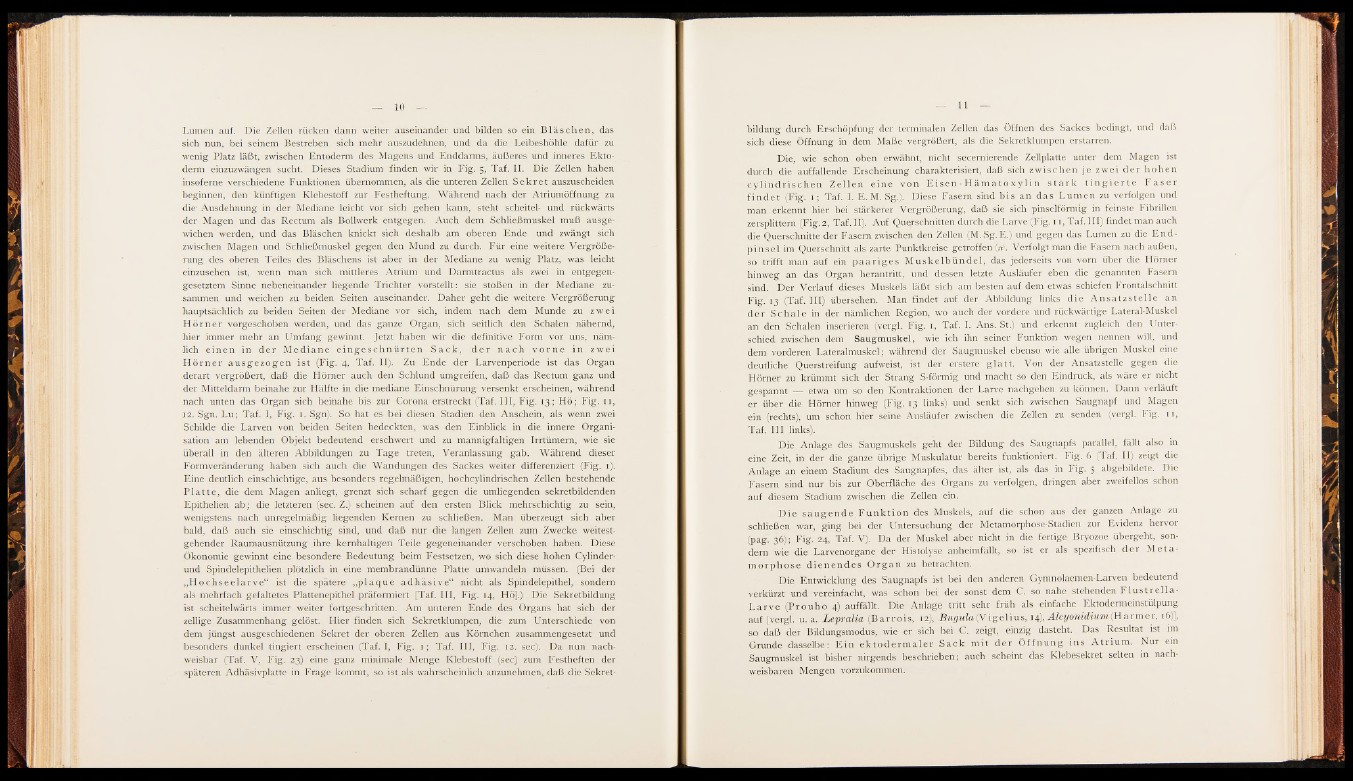
Lumen auf. Die Zellen rücken dann weiter auseinander und bilden so ein B lä s ch en , das
sich nun, bei seinem Bestreben sich mehr auszudehnen, und da die Leibeshöhle dafür zu
wenig Platz läßt, zwischen Entoderm des Magens und Enddarms, äußeres und inneres Ektoderm
einzuzwängen sucht* . Dieses Stadium finden wir in Fig. 5, Taf. II. Die Zellen haben
insoferne verschiedene Funktionen übernommen, als die unteren Zellen S ek re t auszuscheiden
beginnen, den künftigen Klebestoff zur Festheftung. Während nach der Atriumöffnung zu
die- Ausdehnung in der Mediane leicht vor sich gehen kann, steht scheitel- und rückwärts
der Magen und das Rectum als Bollwerk entgegen. Auch dem Schließmuskel muß ausgewichen
werden, und das Bläschen knickt sich deshalb am oberen Ende und zwängt sich
zwischen Magen und Schließmuskel gegen den Mund zu durch. Für eine weitere Vergrößerung
des oberen Teiles des Bläschens ist aber in der Mediane zu wenig Platz, was leicht
einzusehen ist, wenn man sich mittleres Atrium und Darmtractusr -als zwei in entgegengesetztem
Sinne nebeneinander liegende Trichter vorstellt: sie stoßen in der Mediane zusammen
und weichen zu beiden Seiten auseinander. Daher geht die weitere Vergrößerung
hauptsächlich zu beiden Seiten der Mediane vor sich, indem nach dem Munde zu zwe i
Hörner vorgeschoben werden, und das ganze Organ, sich seitlich den Schalen nähernd,
hier immer mehr an Umfang gewinnt. Jetzt haben wir die definitive Form vor uns, nämlich
einen in der Mediane e in g e s ch n ü r ten S a c k , d e r n a ch v o rn e in zwei
Hörner au sg e zo g en is t (Fig. 4, Taf. II). Zu Ende der Larvenperiode ist das Organ
.derart vergrößert, daß die Hörner auch den Schlund umgreifen, daß das Rectum ganz und
der Mitteldarm beinahe zur Hälfte in die mediane Einschnürung versenkt erscheinen, während
nach unten das Organ sich beinahe bis zur Corona erstreckt (Taf. III, Fig. 13; Hö; Fig. n ,
12. Sgn. Lu; Taf. I, Fig. 1. Sgn). So hat es bei diesen Stadien den Anschein, als wenn zwei
Schilde die Larven von beiden Seiten bedeckten, was den Einblick in die innere Organisation
am lebenden Objekt bedeutend erschwert und zu mannigfaltigen Irrtümern, wie sie
überall in den älteren Abbildungen zu Tage treten, Veranlassung gab. Während dieser
Formveränderung haben sich auch die Wandungen des Sackes weiter differenziert (Fig. 1).
Eine deutlich einschichtige, aus besonders regelmäßigen, hochcylindrischen Zellen bestehende
P la tte , die dem Magen anliegt, grenzt sich scharf gegen die umliegenden sekretbildenden
Epithelien ab; die letzteren (sec. Z.) scheinen auf den ersten Blick mehrschichtig zu sein,
wenigstens nach unregelmäßig liegenden Kernen zu schließen. Man überzeugt sich aber
bald, daß auch sie einschichtig sind, und daß nur die langen Zellen zum Zwecke weitestgehender
Raumausnützung ihre kernhaltigen Teile gegeneinander verschoben haben. Diese
Ökonomie gewinnt eine besondere Bedeutung beim Festsetzen, wo sich diese hohen Cylinder-
und Spindelepithelien plötzlich in eine membrandünne Platte umwandeln müssen. (Bei der
„H o ch s e e la rv e “ ist die spätere „p laqu e ad h ä s iv e “ nicht als Spindelepithel, sondern
als mehrfach gefaltetes Plattenepithel präformiert [Taf. III, Fig. 14, Hö].) Die Sekretbildung
ist scheitelwärts immer weiter fortgeschritten. Am unteren Ende des Organs hat sich der
zellige Zusammenhang gelöst. Hier finden sich Sekretklumpen, die zum Unterschiede von
dem jüngst ausgeschiedenen Sekret der oberen Zellen aus Körnchen zusammengesetzt und
besonders dunkel tingiert erscheinen (Taf. I, Fig. 1; Taf. III, Fig. 12. sec). .Da nun nachweisbar
(Taf. V, Fig. 23) eine ganz minimale Menge Klebestoff (sec) zum Festheften der
späteren Adhäsivplatte in Frage kommt, so ist als wahrscheinlich anzunehmen, daß die Sekretbildung
durch Erschöpfung der terminalen Zellen das Öffnen des Sackes bedingt, und daß
sich diese Öffnung in dem Maße vergrößert, als die Sekretklumpen erstarren.
Die, wie schon oben erwähnt, nicht secernierende Zellplatte unter dem Magen ist
durch die auffallende Erscheinung charakterisiert, daß sich zw is ch e n je zwei der hohen
c y lin d r is ch en Z e llen eine von E isen -H äm a to x y lin s t a r k t in g ie r t e F a s e r
fin d e t (Fig. 1; Taf. I. E. M. Sg,). Diese Fasern sind, bis an das Lumen zu verfolgen und
man erkennt hier bei stärkerer Vergrößerung, daß sie sich pinselförmig in feinste Fibrillen
zersplittern (Fig.% Taf. II). Auf Querschnitten durch die Larve (Fig. 11, Taf. III) findet man auch
die Querschnitte der Fasern zwischen den Zellen (M.Sg.E.) und gegen das Lumen zu die E n d p
in se l im Querschnitt als zarte Punktkreise getroffen (tA Verfolgt man die Fasern nach außen,
so trifft man auf ein p a a r ig e s Muske lbünd el, das jederseits von vorn über die Hörner
hinweg an das Organ herantritt, und dessen letzte Ausläufer eben die genannten Fasern
sind. Der Verlauf dieses Muskels läßt sich am besten auf dem etwas schiefen Frontalschnitt
Fig. 13 (Taf. III) übersehen. Man findet auf der Abbildung links die A n sa tz s te lle an
der S ch a le in der nämlichen Region, wo auch der vordere und rückwärtige Lateral-Muskel
an den Schalen inserieren (vergl. Fig. 1, Taf. I. Ans. St.) und erkennt zugleich den Unterschied
zwischen dem Saugmuskel, wie ich ihn seiner Funktion wegen nennen will, und
dem vorderen Lateralmuskel; während der Saugmuskel ebenso wie alle übrigen Muskel eine
deutliche Querstreifung auf weist, ist der er stere glatt. Von der Ansatzstelle gegen die
Hörner zu krümmt sich der Strang S-förmig und macht so den Eindruck, als wäre er nicht
gespannt — etwa um so den Kontraktionen der Larve nachgeben zu können. Dann verläuft
er über die Hörner hinweg (Fig. 13 links) und senkt sich zwischen Saugnapf und Magen
ein (rechts), um schon hier seine Ausläufer zwischen die Zellen zu senden (vergl. Fig. 11,
Taf. III linksfv
Die Anlage des Saugmuskels geht der Bildung des Saugnapfs parallel, fällt also in
eine Zeit, in der die ganze übrige Muskulatur bereits funktioniert. Fig. 6 (Taf. II) zeigt die
Anlage an einem Stadium des Saugnapfes, das älter ist, als das in Fig. 5 abgebildete. Die
Fasern sind nur bis zur Oberfläche des Organs zu verfolgen, dringen aber zweifellos schon
auf diesem Stadium zwischen die Zellen ein.
Die sa u g en d e .F u n k tion des Muskels, auf die schon aus der ganzen Anlage zu
schließen war, ging bei der Untersuchung der Metamorphose-Stadien zur Evidenz hervor
(pag. 36); Fig. 24, Taf. V). Da der Muskel aber nicht in die fertige Bryozoe übergeht, sondern
wie die Larvenorgane der Histolyse anheimfällt, so ist er als spezifisch der M e ta morphose
dienendes Organ zu betrachten.
Die Entwicklung des Saugnapfs ist bei den anderen Gymnolaemen-Larven bedeutend
verkürzt und vereinfacht, was schon bei der sonst dem C. so nahe stehenden F lu s tre lla -
L a rv e (Prouho 4) auffällt. Die Anlage tritt sehr früh als einfache Ektodermeinstülpung
auf [vergl. u. a. Lepralia (Barrois, 12), Bugula(Vigelius, 14), Alcyonidium (J1armer, 16)],
so daß der Bildungsmodus, wie er sich bei 0 . zeigt, einzig dasteht. Das Resultat ist im
Grunde dasselbe: Ein ek tod e rm a ler S ack mit der Öffnung ins Atrium. Nur ein
Saugmuskel ist bisher nirgends beschrieben; auch scheint das Klebesekret selten in nachweisbaren
Mengen vorzukommen.