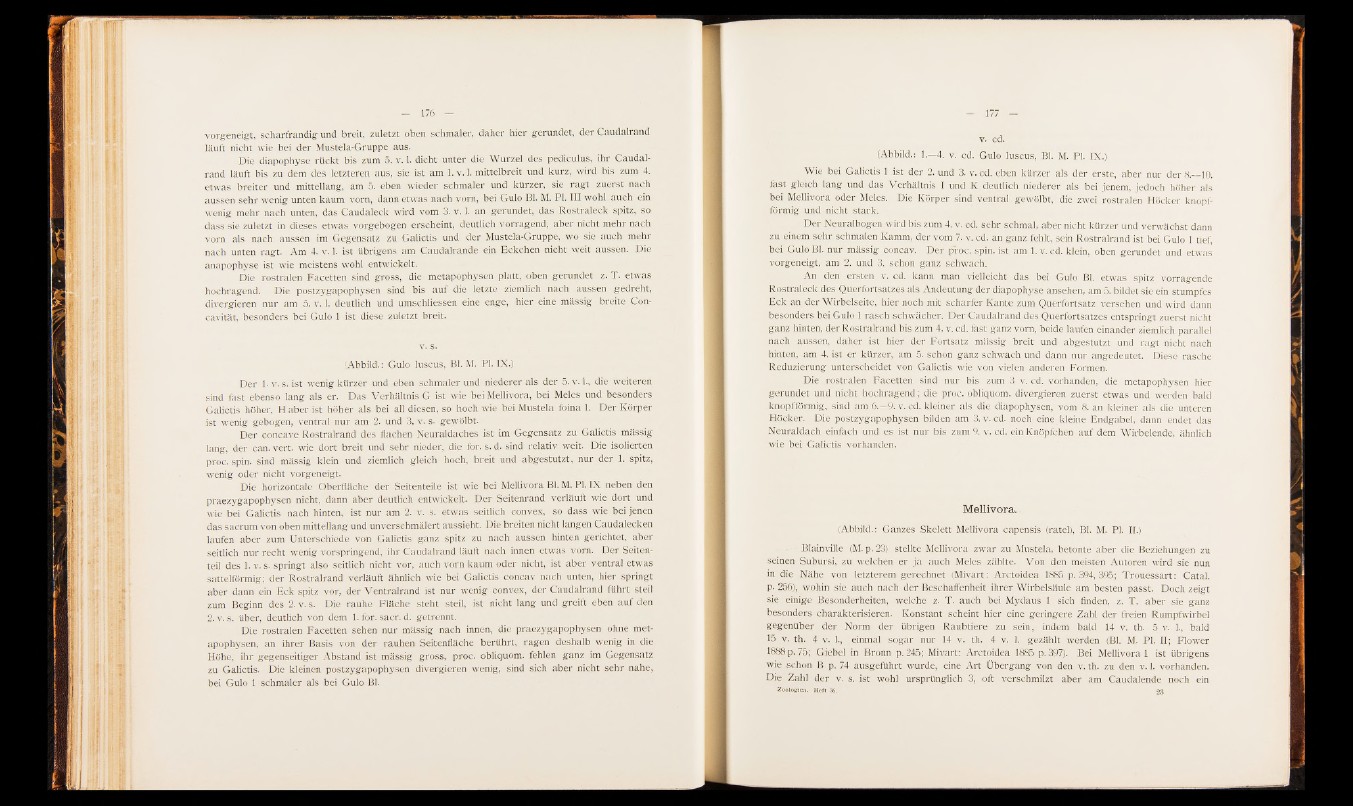
vorgeneigt, scharfrandig und breit, zuletzt oben schmaler, daher hier gerundet, der Caudalrand
läuft nicht wie bei der Mustela-Gruppe aus.
Die diapophyse rückt bis zum 5. v. 1. dicht unter die Wurzel des pediculus, ihr Caudalrand
läuft bis zu dem des letzteren aus, sie ist am 1. vBj mittelbreit und kurz, wird bis zum 4.
etwas breiter und mittellang, am 5. eben wieder schmaler und kürzer, sie ragt zuerst nach
aussen sehr wenig unten kaum vorn, dann etwas nach vorn, bei Gulo Bl. M. PI. III wohl auch ein
wenig mehr nach unten, das Caudaleck wird vom v. 1. an gerundet, das Rostraleck spitz, so
dass sie zuletzt in dieses etwas vorgebogen erscheint, deutlich vorragend, aber nicht mehr nach
vorn als nach aussen im Gegensatz zu Galictis und der Mustela-Gruppe, wo sie auch mehr
nach unten ragt. Am 4. v. 1. ist übrigens am Caudalrande ein Eckchen nicht weit aussen. Die
anapophyse ist wie meistens wohl entwickelt.
Die rostralen Facetten sind gross, die metapophysen platt, oben gerundet z. T. etwas
hochragend. Die postzygapophysen sind bis auf die letzte ziemlich nach aussen gedreht,
divergieren nur am 5. v. 1. deutlich und umschliessen eine enge, hier eine mässig breite Con-
cavität, besonders bei Gulo 1 ist diese zuletzt breit.
v. s.
(Abbild.: Gulo luscus, Bl. M. PL IX.)
Der 1. v. s. ist wenig kürzer und eben schmaler und niederer als d,er 5. v. 1., die weiteren
sind fast ebenso lang als er. Das Verhältnis G ist wie bei Mellivora, bei Meies und besonders
Galictis höher, H aber ist höher als bei all diesen, so hoch wie bei Mustela fbina 1. Der Körper
ist wenig gebogen, ventral nur am 2. und 3. v. s. gewölbt.
Der concave Rostralrand des flachen Neuraldaches ist im Gegensatz zu Galictis mässig
lang, der can. vert. wie dort breit und sehr nieder, die for. s. d. sind relativ weit. Die isolierten
proc. spin. sind mässig klein und ziemlich gleich hoch, breit und abgestutzt, nur der 1. spitz,
wenig oder nicht vorgeneigt.
Die horizontale Oberfläche der Seitenteile ist wie bei Mellivora Bl. M. PL IX neben den
praezygapophysen nicht, dann aber deutlich entwickelt. Der Seitenrand verläuft wie dort und
wie bei Galictis nach hinten, ist nur am 2. v. s. etwas seitlich convex, so dass wie bei jenen
das sacrum von oben mittellang und unverscbmälert aussieht. Die breiten nicht langen Caudalecken
laufen aber zum Unterschiede von Galictis ganz spitz zu nach aussen hinten gerichtet, aber
seitlich nur recht wenig vorspringend, ihr Caudalrand läuft nach innen etwas vorn. Der Seitenteil
des 1. v. s. springt also seitlich nicht vor, auch vorn kaum oder nicht, ist aber ventral etwas
sattelförmig; der Rostralrand verläuft ähnlich wie bei Galictis concav nach unten, hier springt
aber dann ein Eck spitz vor, der Ventralrand ist nur wenig convex, der Caudalrand führt steil
zum Beginn des 2. v. s. Die rauhe Fläche steht steil, ist nicht lang und greift eben auf den
2. v. s. über, deutlich von dem 1. for. sacr. d. getrennt.
Die rostralen Facetten sehen nur mässig nach innen, die praezygapophysen ohne metapophysen,
an ihrer Basis von der rauhen Seitenfläche berührt, ragen deshalb wenig in die
Höhe, ihr gegenseitiger Abstand ist mässig gross, proc. obliquom. fehlen ganz im Gegensatz
zu Galictis. Die kleinen postzygapophysen divergieren wenig, sind sich aber nicht sehr nahe,
bei Gulo 1 schmaler als bei Gulo BL
v. cd.
(Abbild.: 1.—4. v. cd. Gulo luscus, BL M. PL IX.)
Wie bei Galictis 1 ist der 2. und 3. v. cd. eben kürzer als der erste, aber nur der 8.—10.
fast gleich lang und das Verhältnis I und K deutlich niederer als bei jenem, jedoch höher als
bei Mellivora oder Meies. Die Körper sind ventral gewölbt, die zwei rostralen Höcker knopfförmig
und nicht stark.
Der Neuralbogen wird bis zum 4. v. cd. sehr schmal, aber nicht kürzer und verwächst dann
zu einem sehr schmalen Kamm, der vom 7, v. cd. an ganz fehlt, sein Rostralrand ist bei Gulo 1 tief,
bei Gulo BL nur mässig concav. Der proc. spin. ist am 1. v. cd. klein, oben gerundet und etwas
vorgeneigt, am 2. und 3. schon ganz schwach.
An den ersten v. ed. kann man vielleicht das bei Gulo Bl. etwas spitz vorragende
Rostraleck des Querfortsatzes als Andeutung der diapophyse ansehen, am 5. bildet sie ein stumpfes
Eck an der Wirbelseite, hier noch mit scharfer Kante zum Querfortsatz versehen und wird dann
besonders bei Gulo 1 rasch schwächer. Der Caudalrand des Querfortsatzes entspringt zuerst nicht
ganz hinten, der Rostralrand bis zum 4. v. cd. fast ganz vorn, beide laufen einander ziemlich parallel
nach aussen, daher ist hier der Fortsatz mässig breit und abgestutzt und ragt nicht nach
hinten, am 4. ist er kürzer, am 5. schon ganz schwach und dann nur angedeutet. Diese rasche
Reduzierung unterscheidet von Galictis wie von vielen anderen Formen.
Die rostralen Facetten sind nur bis zum 3 v. cd. vorhanden, die metapophysen hier
gerundet und nicht hochragend; die proc. obliquom. divergieren zuerst etwas und werden bald
knopfiormig, sind am 6.-9. v. cd. kleiner als die diapophysen, vom 8. an kleiner als die unteren
Höcker. Die postzygapophysen bilden am 3. v. cd. noch eine kleine Endgabel, dann endet das
Neuraldach einfach und es ist nur bis zum 9. v. cd. ein Knöpfchen auf dem Wirbelende, ähnlich
wie bei Galictis vorhanden.
Mellivora.
(Abbild.: Ganzes Skelett Mellivora capensis (ratel), Bl. M. PL II.)
Blainville (M. p. 23) stellte Mellivora zwar zu Mustela, betonte aber die Beziehungen zu
seinen Subursi, zu welchen er ja auch Meies zählte. Von den meisten Autoren wird sie nun
in die Nähe von letzterem gerechnet (Mivart: Arctoidea 1885 p. 394, 395; Trouessart: Catal.
p. 256), wohin sie auch nach der Beschaffenheit ihrer Wirbelsäule am besten passt. Doch zeigt
sie einige Besonderheiten, welche z. T. auch bei Mydaus 1 sich finden, z. T. aber sie ganz
besonders charakterisieren. Konstant scheint hier eine geringere Zahl der freien Rumpfwirbel
gegenüber der Norm der übrigen Raubtiere zu sein, indem bald 14 v. th. 5 v. 1., bald
15 v. th. 4 v. L, einmal sogar nur 14 v. th. 4 v. 1. gezählt werden (Bl. M. PL II; Flower
1888 p. 75; Giebel in Bronn p. 245; Mivart: Arctoidea 1885 p. 397). Bei Mellivora 1 ist übrigens
wie schon B p. 74 ausgeführt wurde, eine Art Übergang von den v. th. zu den v. 1. vorhanden.
Die Zahl der v. s. ist wohl ursprünglich 3, oft verschmilzt aber am Caudalende noch ein
Zoologica. Heft 36. 23