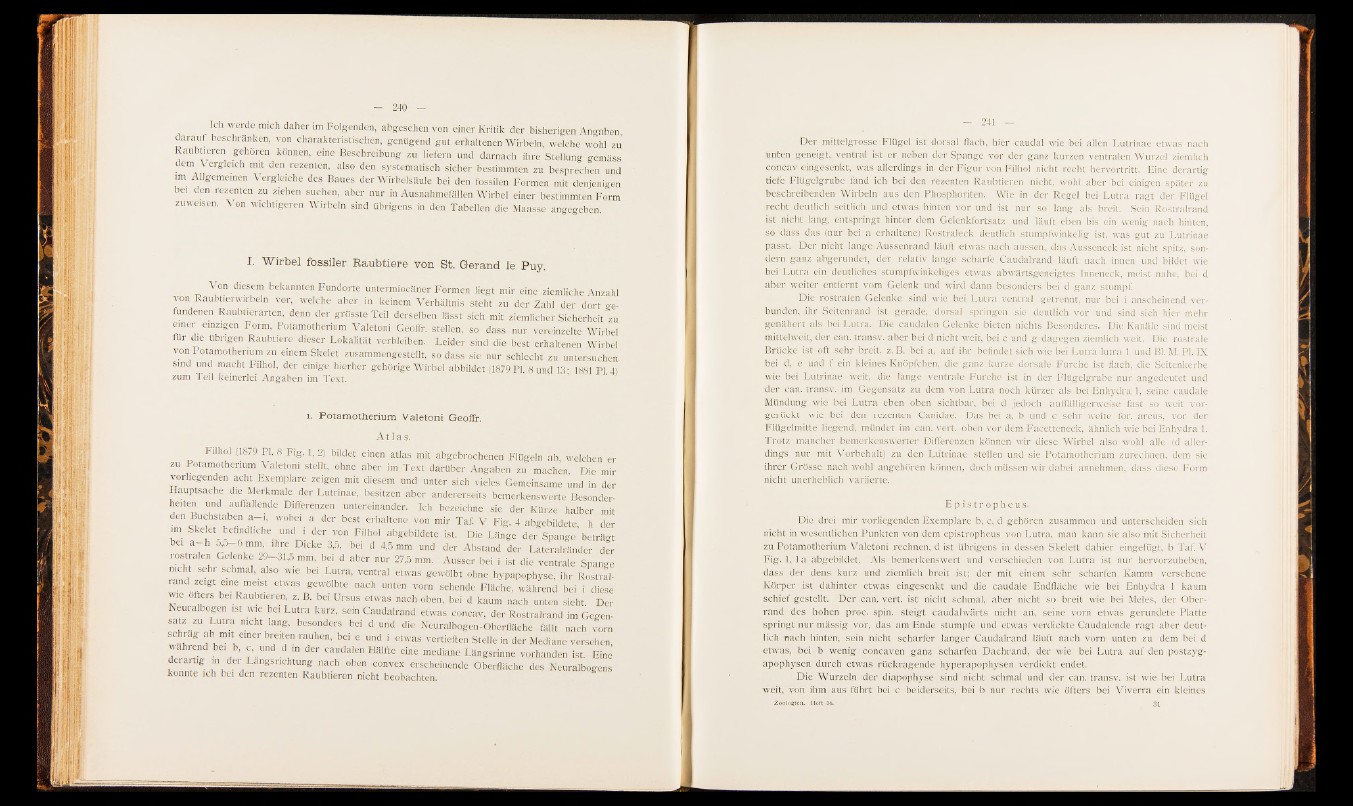
Ich werde mich, daher im Folgenden, abgesehen von einer Kritik der bisherigen Angaben
darauf beschränken, von charakteristischen, genügend gut erhaltenen Wirbeln, welche wohl zu
Raubtieren gehören können, eine Beschreibung zu liefern und darnach ihre Stellung gemäss
dem Vergleich mit den rezenten, also den systematisch sicher bestimmten zu besprechen und
im Allgemeinen Vergleiche des Baues der Wirbelsäule bei den fossilen Formen mit denjenigen
bei den rezenten zu ziehen suchen, aber nur in Ausnahmefällen Wirbel einer bestimmten Form
zuweisen. Von wichtigeren Wirbeln sind übrigens in den Tabellen die Maasse angegeben.
I. Wirbel fossiler Raubtiere von St. Gerand le Puy.
Von diesem bekannten Fundorte untermiocäner Formen liegt mir cbe ziemliche Anzahl
von Raubtierwirbeln vor, welche aber in keinem Verhältnis steht zu der Zahl der dort °'e-
fundenen Raubtierarten, denn der grösste Teil derselben lässt sich mit ziemlicher Sicherheit zu
einer einzigen Form, Pötamotherium Valetoni Geoffr. stellen, so dass nur- vereinzelte Wirbel
für die übrigen Raubtiere dieser Lokalität verbreiben. Leider sind die best erhaltenen Wirbel
von 1 otamothenum zu einem Skelet zusammengestellt, so dass sie nur schlecht zu untersuchen
sind und macht Filhol, der einige hierher gehörige Wirbel abbildet (1879 PI. 8 und 13- 1881 PI. 4)
zum Teil keinerlei Angaben im Text.
i. Potamotherium Valetoni Geoffr.
A tla s .
Filhol (1879 PI. 8 Fig. 1, 2) bildet einen atlas mit abgebrochenen Flügeln ab, welchen er
zu Potamotherium Valetoni stellt, ohne aber im Text darüber: Angaben zu machen. Die mir
vorliegenden acht Exemplare zeigen mit diesem und unter sich vieles Gemeinsame und in der
Hauptsache die Merkmale der Lutrinae, besitzen aber andererseits bemerkenswerte Besonder-
heiten und auffallende Differenzen untereinander. Ich bezeichne sie der Kürze halber mit
den Buchstaben a - i, wobei a der best erhalten©'von mir Taf. V Fig. 4 abgebildete h der
im Skelet befindliche und i der von Filhol abgebildete ist: Die Länge der Spange’beträgt
, a . m m m m m bei d 4,5 mm ™d der Abstand der . Lateralränder der
rostraten Gelenke 29-31,5 mm, bei d aber nur 27,5 mm. Ausser bei i ist die ventrale Spange
nicht sehr sehmal, also wie bei Lutra, ventral etwas gewölbt ohne hypapophyse, ihr Rostralrand
zeigt eine meist etwas gewölbte nach unten vorn sehende Fläche, während bei i diese
wie öfters bei Raubtieren; z. B. bei Ursus etwas nach oben, bei d kaum nach unten sieht Der
Neuralbogen ist wie bei Lutra kurz, sein Caudalrand etwas concav, der Rostralrand im Gegensatz
zu Lutra nicht lang, besonders bei d und die Neuralbogen-Oberfläche fällt nach vorn
schräg ab mit einer breiten rauhen, bei e und i etwas vertieften Stelle in der Mediane versehen,
während bei b, c und d m der caudalen Hälfte eine mediane Längsrinne vorhanden ist. Lind
derartig m der Längsrichtung nach oben convex erscheinende Oberfläche des Neuralbogens
konnte ich bei den rezenten Raubtieren nicht beobachten.
Der mittelgrosse Flügel ist dorsal flach, hier caudal wie bei allen Lutrinae etwas nach
unten geneigt, ventral ist er neben der Spange vor der ganz kurzen ventralen Wurzel ziemlich
concav eingesenkt, was allerdings in der Figur von Filhol nicht recht hervortritt. Eine derartig
tiefe Flügelgrube fand ich bei den rezenten Raubtieren nicht, wohl aber bei einigen später zu
beschreibenden Wirbeln aus den Phosphoriten. Wie in der Regel bei-Lutra ragt der Flügel
recht deutlich seitlich und etwas hinten vor und ist nur so lang als breit. Sein Rostralrand
ist nicht lang, entspringt hinter dem Gelenkfortsatz und läuft eben bis ein wenig nach hinten,
so dass das (nur bei a erhaltene) Rostraleck deutlich stumpfwinkelig ist, was gut zu Lutrinae
passt. Der nicht lange Aussenrand läuft etwas nach aussen, das Ausseneck ist nicht spitz, sondern
ganz abgerundet, der relativ langé scharfe Caudalrand läuft nach innen und bildet wie
bei Lutra ein deutliches stumpfwinkeliges etwas abwärtsgeneigtes Inneneck, meist nahe, bei d
aber weiter entfernt vom Gelenk und wird dann besonders bei d ganz stumpf.
Die; rostraien Gelenke: sind wie bei Lutra ventral getrennt, nur bei i anscheinend verbunden,
ihr Seitenrand ist gerade, dorsal springen sie deutlich vor und sind sich hier mehr
genähert als bei Lutra. Die caudalen Gelenke bieten nichts Besonderes. Die Kanäle sind meist
mittelweit, der can. transv. aber.bei d nicht weit, bei e und g dagegen ziemlich weit. Die rostrale
Brücke ist oft sehr breit, z. B. bei a, auf ihr befindet sich wie bei Lutra lutra 1 und Bl. M. Pl. IX
bei d, e und f ein kleines Knöpfchen, die ganz kurze dorsale Furche ist flach, die Seitenkerbe
wie bei Lutrinae weit, die lange ventrale Furche ist in der Flügelgrube nur angedeutet und
der can. transv. im Gegensatz zu dem von Lutra noch kürzer als bei Enhydra 1, seine caudale
Mündung wie bei Lutra eben oben sichtbar, bei d jedoch . auffälligerweise fast so weit vorgerückt
wie bei den rezenten Canidae. Das bei a, b und c sehr weite for. arcus, vor der
Flügelmitte liegend, mündet im can. vert. oben vor dem Facetteneck, ähnlich wie bei Enhydra 1.
Trotz mancher bemerkenswerter Differenzen können wir diese Wirbel also wohl alle (d allerdings
nur mit Vorbehalt) zu den Lutrinae stellen und sie Potamotherium zurechnen, dem sie
ihrer Grösse nach wohl angehören können, doch müssen wir dabei annehmen, dass diese Form
nicht unerheblich variierte.
E p is t r o p h e u s .
Die drei mir vorliegenden Exemplare h, c, d gehören zusammen und unterscheiden sich
nicht in wesentlichen Punkten von dem epistropheus von Lutra, man kann sie also mit Sicherheit
zu.Potamotherium Valetoni rechnen, d ist übrigens in dessen Skelett dahier eingefügt, b Taf. V
Fig. 1, l a abgebildet. Als bemerkenswert und verschieden von Lutra ist nur hervorzuheben,
dass der dens kurz und ziemlich breit ist; der mit einem sehr scharfen Kamm versehene
Körper ist dahinter etwas eingesenkt und die caudale Endfläche wie bei Enhydra 1 kaum
schief gestellt. Der can. vert.-ist nicht schmal, aber nicht so breit wie bei Mêles, der Oberrand
des hohen proc. spin. steigt caudalwärts nicht an, seine vorn etwas gerundete Platte
springt nur mässig vor, das am Ende stumpfe und etwas verdickte Caudalende ragt aber deutlich
nach hinten, sein nicht scharfer langer Caudalrand läuft nach vorn unten zu dem bei d
etwas, bei b wenig concaven ganz scharfen Dachrand, der wie bei Lutra auf den postzyg-
apophysen durch etwas rückragende hyperapophysen verdickt endet.
Die Wurzeln der diapophyse sind nicht schmal und der can. transv. ist wie bei Lutra
weit, von ihm aus führt bei c beiderseits, bei b nur rechts wie öfters bei Viverra ein kleines
Zoologica. Heft 36., - 3 1