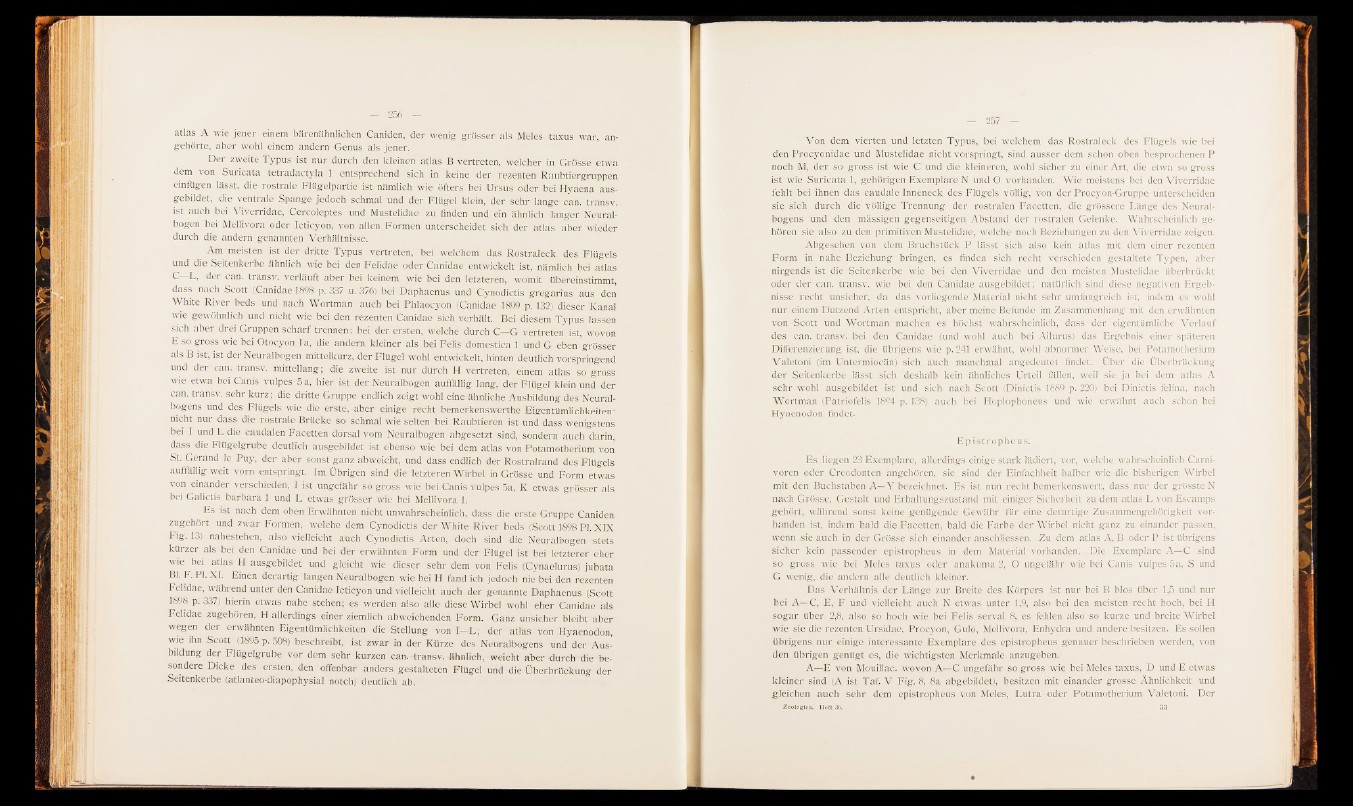
atlas A wie jener einem bärenähnlichen Caniden, der wenig grösser als Meies taxus war, angehörte,
aber wohl einem ändern Genus als jener.
Der zweite Typus ist nur durch den kleinen atlaS II vertreten, welcher in GröJ|e etwa,
dem von Suricata tetradactyla 1 entsprechend sich in keine der rezenten Raubtiergruppen
einfügen lässt, die rostrale Flügelpartie ist nämlich wie öfters bei Ursus oder bei Hyaena aiÜJ!
gebildet, die ventrale Spange jedoch schmal und der Flügel klein, def 'ighr lange-can. transv.
ist auch bei Viverridäe, Cerooleptes und Mustelidalfzu finden und ein ähnlich langer Neuralbogen
bei Mellivora oder Icticyön, von allen Formen unterscheidet sich der atlas aber wieder
durch die ändern genannten Verhältnisse.
Am meisten ist der dritte Typus vertreten, bei welchem das Rostrale!# des Flüge®
und die Seitenkerbe ähnlich wie bei den Felidae oder Canidae entwickelt ist, nämlich bei atlas
c ~ Li der can- transv. verläuft aber bei keinem wie bei den letzteren, womit übereinstimmt,
dass nach Scott (Ganidae 1898 p. 337 u. 376) bei Daphaenus und Cynodictis gregarius äus f c n
White River beds und nach Wortman auch bei Phlaoeyon (Canidae 1899 p.'ii|j§ dieser Kanal
wie gewöhnlich und nicht wie bei den rezenten Canidae Ä h verhält. Bei diesem Typus lassen
sich aber drei Gruppen scharf trennen: bei der ersten, welche durch C—G vertreten ist, wovon
Eso gross wie bei "Ótoeyon la, die ändern kleiner Ms bei Felis domesticai und G eben grösser
als B ist, ist der Neuralbogen mittelkurz, der Flügel wohl entwickelt, hinten deutlich vorspringend
und der can. transv. mittellang; die zweite ist nur durch H vertreten, einem atlas so gross
wie etwa bei Canis vulpes 5 a, hier ist der Neuralbogen auffällig lang, der Flügel-klein und der
can. tränsv. sehr kurz; die dritte Gruppe endlich zeigt wohl eine ähnliche Ausbildung dis Neuralbogens
und des Flügels wie die erste, aber einige recht bemerkenswerthe-Eigentümlichkeiten :
nicht nur dass die rostrale Brücke Äschm a l wie selten bei Raubtieren ist und dass wenigstens
bei I und L die caudalen Facetten dorsal vom Neuralbogen abgesetzt sind, sondern auch darin,
dass die Flügelgrube deutlich ausgebildet ist ebenso wie bei dem atlas von Potamotherium von'
St. Gerand le Puy, der aber sonst ganz abweicht, und dass endlich der Rostralrand des Flügels
auffällig weit vorn entspringt. Im Übrigen sind die letzteren Wirbel in Grösse und Form etwas
von einander verschieden, I ist ungefähr so gross wie bei Canis vulpes 5a, K etwas grösser als
bei Galietis barbara 1 und L etwas grösser wie bei Mellivora 1.
Es ist nach dem oben Erwähnten nicht unwahrscheinlich, dass die erste Gruppe Caniden
zugehört und zwar Formen, welche dem Cynodictis der White River beds (Scott1898 PI. XIX
P ig . 13) nahestehen, also vielleicht auch Cynodictis Arten, doch sind die Neuralbogen stets
kürzer als bei den Canidae-und bei der erwähnten Form und der Flügel , ist bei letzterer eher
wie bei atlas H ausgebildet und-gleicht wie dieser sehr dem von Fehs (Cynaelurus) jubata
Bl. F. Pi. XI. Einen derartig langen Neuralbogen wie bei H fand ich jedoch nie bei den rezenten
Fehdae, während unter den Canidae Icticyön und vielleicht auch der genannte Daphaenus (Scott
1898 p. 337) hierin etwas nahe stehen ; es werden also alle diese Wirbel wohl eher Canidae als
Felidae zugehören, H allerdings einer ziemlich abweichenden Form. Ganz unsicher bleibt aber
wegen der erwähnten Eigentümlichkeiten die Stellung von I -L ; der atlas von Hyaenodon,
wie ihn Scott' (1895 p. 508) beschreibt, ist zwar in der Kürze dès Neuralbogens und der Ausbildung
der Flügelgrube vor dem'sehr kurzen can.-transv. ähnlich, weicht aber durch die-bt~
sondere Dicke des ersten, den offenbar anders gestalteten Flügel und die Überbrückung der
Seitenkerbe (atlanteo-diapophysial notch) deutlich ab.
Von dem vierten und letzten Typus, bei welchem das Rostraleck des Flügels wie bei
den Procyonidae und Mustelidae nicht vorspringt, sind ausser dem schon oben besprochenen P
noch M, der so gross ist wie C und die kleineren, wohl sicher zu einer Art, die etwa so gross
ist wie Suricata 1, gehörigen Exemplare N und O vorhanden. Wie meistens bei den Viverridäe
fehlt bei ihnen das caudale Inneneck des Flügels völlig, von der Procyon-Gruppe unterscheiden
sie sich durch die völlige Trennung der rostralen Facetten, die grössere Länge des Neuralbogens
und den mässigen gegenseitigen Abstand der rostralen Gelenke. Wahrscheinlich gehören
sie also zu den primitiven Mustelidae, welche noch Beziehungen zu den Viverridäe zeigen.
Abgesehen von dem Bruchstück P lässt sich also kein atlas mit dem einer rezenten
Form in nahe Beziehung bringen, es finden sich recht verschieden gestaltete Typen, aber
nirgends ist die Seitenkerbe wie bei den Viverridäe und den meisten Mustelidae überbrückt
oder der can. transv. wie bei den Canidae ausgebildet; natürlich sind diese negativen Ergebnisse
recht unsicher, da das vorliegende Material nicht sehr umfangreich ist, indem es wohl
nur einem Dutzend Arten entspricht, aber meine Befunde im Zusammenhang mit den erwähnten
von Scott und Wortman machen es höchst wahrscheinlich, dass der eigentümliche Verlauf
des can. transv. bei den Canidae (und wohl auch bei Ailurus) das Ergebnis einer späteren
Differenzierung ist, die übrigens wie p. 241 erwähnt, wohl abnormer Weise, bei Potamotherium
Valetoni (im Untermiocän) sich auch manchmal angedeutet findet. Über die Überbrückung
der Seitenkerbe lässt sich deshalb kein ähnliches Urteil fällen, weil sie ja bei dem atlas A
sehr wohl ausgebildet ist und sich nach Scott (Dinictis 1889 p. 220) bei Dinictis felina, nach
Wortman (Patriofelis 1894 p. 138) auch bei Hoplophoneus und wie erwähnt auch schon bei
Hyaenodon findet.
Ep is tro p h eu s.
Es liegen 23 Exemplare, allerdings einige stark lädiert, vor, welche wahrscheinlich Carni-
voren oder Creodonten angehören, sie sind der Einfachheit halber wie die bisherigen Wirbel
mit den Buchstaben A—Y bezeichnet. Es ist nun recht bemerkenswert, dass nur der grösste N
nach Grösse, Gestalt und Erhaltungszustand mit einiger Sicherheit zu dem atlaS L von Escamps
gehört, während sonst keine genügende Gewähr für eine derartige Zusammengehörigkeit vorhanden
ist, indem bald die Facetten, bald die Farbe der Wirbel nicht ganz zu einander passen,
wenn sie auch in der Grösse sich einander anschliessen. Zu dem atlas A, B oder P ist übrigens
Sicher kein passender epistropheus in dem Material vorhanden. Die Exemplare A-iC sind
so gross wie bei Meies taxus oder anakuma 2, O ungefähr wie hei Canis vulpes 5a, S und
G wenig, die ändern alle deutlich kleiner.
Das Verhältnis der Länge zur Breite des Körpers ist nur bei B blos über 1,5 und nur
bei A—C, E, F und vielleicht auch N etwas unter 1,9, also bei den meisten recht hoch, bei H
sogar über 2,8, also so hoch wie bei Felis serval 8, es fehlen also so kurze und breite Wirbel
wie sie die rezenten Ursidae, Procyon, Gulo, Mellivora, Enhydra und andere besitzen. Es sollen
übrigens nur einige interessante Exemplare des epistropheus genauer beschrieben werden, von
den übrigen genügt es, die wichtigsten Merkmale anzugeben.
A—E von Mouillac. wovon A—C ungefähr so gross wie bei Meies taxus, D und E etwas
kleiner sind (A ist Taf. V Fig. 8, 8a abgebildet), besitzen mit einander grosse Ähnlichkeit und
gleichen auch sehr dem epistropheus von Meies, Lutra oder Potamotherium Valetoni. Der
Zoologica. Heft 36. , 33