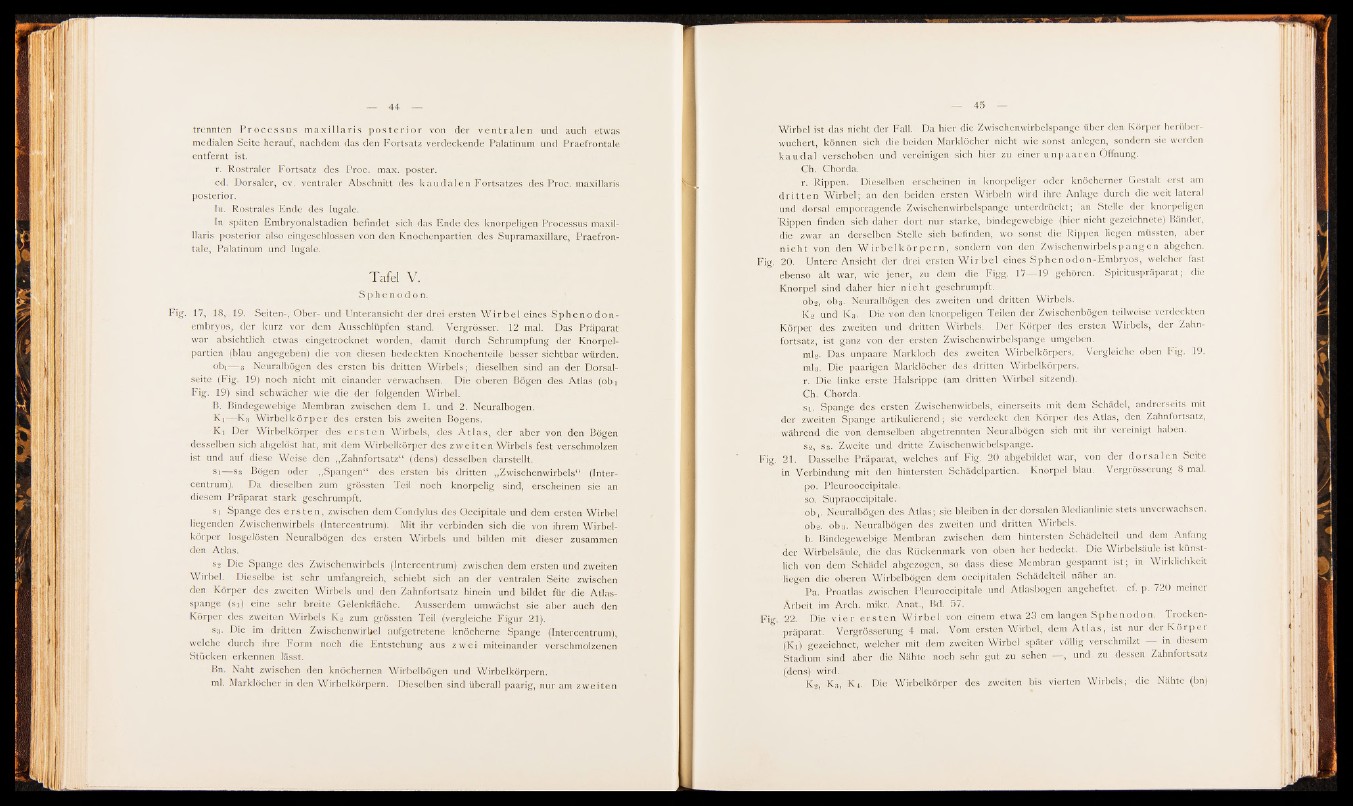
trennten P ro c e s s u s m a x illa r is p o s t e r io r von der v e n tr a le n und auch etwas
medialen Seite herauf, nachdem das den Fortsatz verdeckende Palatinum und Praefrontale
entfernt ist.
r. Rostraler Fortsatz des Proc. max. poster.
cd. Dorsaler, cv. ventraler Abschnitt des k a u d a le n Fortsatzes des Proc. maxillaris
posterior.
Iu. Rostrales Ende des Iugale.
In späten Embryonalstadien befindet sich das Ende des knorpeligen Processus maxil-
llaris posterior also eingeschlossen von den Knochenpartien des Supramaxillare, Praefrontale,
Palatinum und Iugale.
Tafel V.
S p h e n o d o n .
17, 18, 19. Seiten-, Ober- und Unteransicht der drei ersten W irb e l eines S p h e n o d o n -
embryos, der kurz vor dem Ausschlüpfen stand. Vergrösser. 12 mal. Das Präparat
war absichtlich etwas eingetrocknet worden, damit durch Schrumpfung der Knorpelpartien
(blau angegeben) die von diesen bedeckten Knochenteile besser sichtbar würden.
obi—8 Neuralbögen des ersten bis dritten Wirbels; dieselben sind an der Dorsalseite
(Fig. 19) noch nicht mit einander verwachsen. Die oberen Bögen des Atlas (obi
Fig. 19) sind schwächer wie die der folgenden Wirbel.
B. Bindegewebige Membran zwischen dem 1 . und 2. Neuralbogen.
Ki—K3 W irb e lk ö rp e r des ersten bis zweiten Bogens.
Ki Der Wirbelkörper des e r s t e n Wirbels, des A tla s , der aber von den Bögen
desselben sich abgelöst hat, mit dem Wirbelkörper des zw e ite n Wirbels fest verschmolzen
ist und auf diese Weise den „Zahnfortsatz“ (dens) desselben darstellt.
si—S3 Bögen oder „Spangen“ des ersten bis dritten „Zwischenwirbels“ (Intercentrum).
Da dieselben zum grössten Teil noch knorpelig sind, erscheinen sie an
diesem Präparat stark geschrumpft.
si Spange des e r s t e n , zwischen dem Condylus des Occipitale und dem ersten Wirbel
liegenden Zwischenwirbels (Intercentrum). Mit ihr verbinden sich die von ihrem Wirbelkörper
losgelösten Neuralbögen des ersten Wirbels und bilden mit dieser zusammen
den Atlas.
S2 Die Spange des Zwischenwirbels (Intercentrum) zwischen dem ersten und zweiten
Wirbel. Dieselbe ist sehr umfangreich, schiebt sich an der ventralen Seite zwischen
den Körper des zweiten Wirbels und den Zahnfortsatz hinein und bildet für die Atlas-
spange (si) eine sehr breite Gelenkfläche. Ausserdem umwächst sie aber auch den
Körper des zweiten Wirbels K2 zum grössten Teil (vergleiche Figur 21).
S 3 . Die im dritten Zwischenwirbel aufgetretene knöcherne Spange (Intercentrum)
welche durch ihre Form noch die Entstehung aus zw e i miteinander verschmolzenen
Stücken erkennen lässt.
Bn. Naht zwischen den knöchernen Wirbelbögen und Wirbelkörpern.
ml. Marklöcher in den Wirbelkörpern. Dieselben sind überall paarig, nur am zweiten
Wirbel ist das nicht der Fall. Da hier die Zwischenwirbelspange über den Körper herüberwuchert,
können sich die beiden Marklöcher nicht wie sonst anlegen, sondern sie werden
k a u d a l verschoben und vereinigen sich hier zu einer u n p a a r e n Öffnung.
Ch. Chorda.
r. Rippen. Dieselben erscheinen in knorpeliger oder knöcherner Gestalt erst am
d r i t t e n Wirbel; an den beiden ersten Wirbeln wird ihre Anlage durch die weit lateral
und dorsal emporragende Zwischenwirbelspange unterdrückt; an Stelle der knorpeligen
Rippen finden sich daher dort nur starke, bindegewebige (hier nicht gezeichnete) Bänder,
die zwar an derselben Stelle sich befinden, wo sonst die Rippen liegen müssten, aber
n ic h t von den W irb e l k ö r p e rn , sondern von den Zwischenwirbelspangen abgehen.
20. Untere Ansicht der drei ersten W irb e l eines Sphenodon-Embryos, welcher fast
ebenso alt war, wie jener, zu dem die Figg. 17—19 gehören. Spirituspräparat; die
Knorpel sind daher hier n ic h t geschrumpft.
ob2, ob3. Neuralbögen des zweiten und dritten Wirbels.
K2 und K3. Die von den knorpeligen Teilen der Zwischenbögen teilweise verdeckten
Körper des zweiten und dritten Wirbels. Der Körper des ersten Wirbels, der Zahnfortsatz,
ist ganz von der ersten Zwischenwirbelspange umgeben.
ml2- Das unpaare Markloch des zweiten Wirbelkörpers. Vergleiche oben Fig. 19.
ml3. Die paarigen Marklöcher des dritten Wirbelkörpers.
r. Die linke erste Halsrippe (am dritten Wirbel sitzend).
Ch. Chorda.
51. Spange des ersten Zwischenwirbels, einerseits mit dem Schädel, andrerseits mit
der zweiten Spange artikulierend; sie verdeckt den Körper des Atlas, den Zahnfortsatz,
während die von demselben abgetrennten Neuralbögen sich mit ihr vereinigt haben.
52, S 3 . Zweite und dritte Zwischenwirbelspange.
21. Dasselbe Präparat, welches auf Fig. 20 abgebildet war, von der d o r s a le n Seite
in Verbindung mit den hintersten Schädelpartien. Knorpel blau. Vergrösserung 8 mal.
po. Pleurooccipitale.
so. Supraoccipitale.
ob„ Neuralbögen des Atlas; sie bleiben in der dorsalen Medianlinie stets unverwachsen.
ob2- ob 3. Neuralbögen des zweiten und dritten Wirbels.
b. Bindegewebige Membran zwischen dem hintersten Schädelteil und dem Anfang
der Wirbelsäule, die das Rückenmark von oben her bedeckt. Die Wirbelsäule ist künstlich
von dem Schädel abgezogen, so dass diese Membran gespannt ist; in Wirklichkeit
liegen die oberen Wirbelbögen dem occipitalen Schädelteil näher an.
Pa. Proatlas zwischen Pleuroccipitale und Atlasbogen angeheftet, cf. p. 720 meiner
Arbeit im Arch. mikr. Anat., Bd. 57.
22. Die v i e r e r s t e n W irb e l von einem etwa 23 cm langen S p h en o d o n . Trockenpräparat.
Vergrösserung 4 mal. Vom ersten Wirbel, dem A tla s , ist nur der K ö rp e r
(Ki) gezeichnet, welcher mit dem zweiten Wirbel später völlig verschmilzt in diesem
Stadium sind aber die Nähte noch sehr gut zu sehen —, und. zu dessen Zahnfortsatz
(dens) wird.
Kg, K3, K4. Die Wirbelkörper des zweiten bis vierten Wirbels; die Nähte (bn)