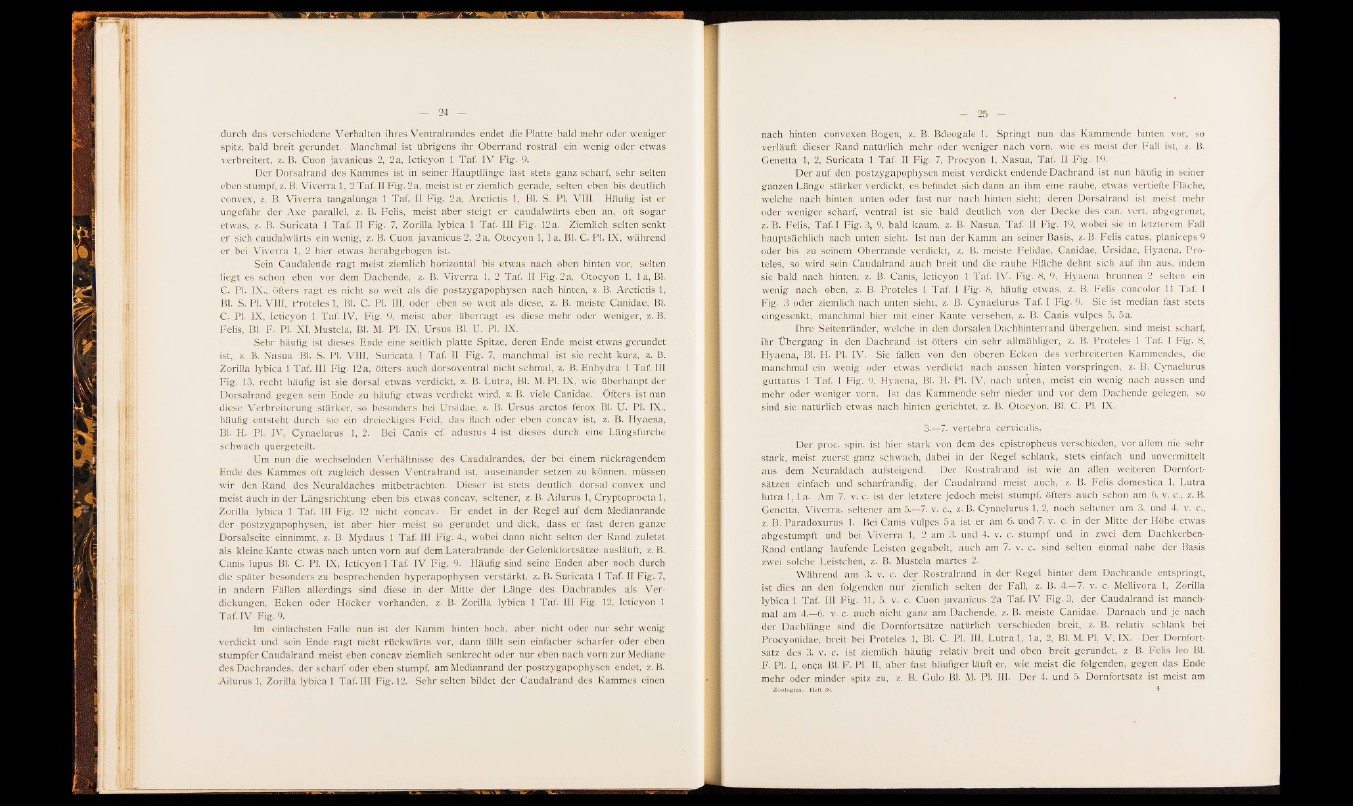
durch das verschiedene Verhalten ihres Ventralrandes endet die Platte bald mehr öder weniger
spitz, bald breit gerundet. Manchmal ist übrigens ihr Oberrand rostral ein’ wenig oder etwas
verbreitert, z.B. Cuon javanicus 2, 2a, Icticyon 1 Taf. IV Fig. 9.
Der Dorsalrand des Kammes ist in seiner Hauptlänge fast stets ganz scharf, sehr selten
eben stumpf, z. B. Viverra 1, 2 Taf. II Fig. 2a, meist ist er ziemlich gerade, selten eben bis deutlich
convex, z. B. Viverra tangalunga 1 Taf. II Fig. 2 a, Arctictis 1, Bl. S. PI. VIIL Häufig ist er
ungefähr der Axe parallel, z. B. Felis, meist aber steigt er caudalwärts eben an, oft sogar
etwas, z. B. Suricata 1 Taf. II Fig. 7, Zorilla lybica 1 Taf. III Fig. 12a. Ziemlich selten senkt
er sich caudalwärts ein wenig, z. B. Cuon javanicus 2, 2 a, Otocyon 1, la , Bl. C. PI. IX, während
er bei Viverra 1, 2 hier etwas herabgebogen ist.
Sein Caudalende ragt meist ziemlich horizontal bis etwas nach oben hinten vor, selten
liegt es schon eben vor dem Dachende, z. B. Viverra 1, 2 Taf. II Fig.2a, Otocyon 1, la , Bl.
C. PI. IX., öfters ragt es nicht so weit als die postzygapophysen nach hinten, z. B. Arctictis 1,
Bl. S. PI. VIII, Proteles 1, Bl. C. PI. III, oder eben so weit als diese, z. B. meiste Canidae, Bl.
C. PI. IX, Icticyon 1 Taf. IV, Fig. 9, meist aber überragt es diese mehr oder weniger, z.B..
Felis, Bl. F. PI. XI, Mustela, Bl. M. PI. IX, Ursus Bl. TJ.-Pl. IX.
Sehr häufig ist dieses Ende eine seitlich platte Spitze, deren Ende meist etwas gerundet
ist, z. B. Nasua Bl. S. PI. VIII, Suricata 1 Taf. II Fig. 7, manchmal ist sie recht kurz, z. B.
Zorilla lybica 1 Taf. III Fig. 12 a, öfters auch dorsoventral nicht schmal, z. B. Enhydra 1 Taf. III
Fig. 13, recht häufig ist sie dorsal etwas verdickt, z. B. Lutra, Bl. M. PI. IX, wie überhaupt der
Dorsalrand gegen sein Ende zu häufig etwas verdickt wird, z. B. viele Canidae. Öfters ist nun
diese Verbreiterung stärker, so besonders bei Ursidae, z. B. Ursus arctos ferox Bl. U. PI. IX.,
häufig entsteht durch sie ein dreieckiges Feld, das flach oder eben concav ist, z. B. Hyaena,.
Bl. H. PI. IV, Cynaelurus 1, 2. Bei Canis cf. adustus 4 ist dieses durch eine Längsfurche
schwach quergeteilt.
Um nun die wechselnden Verhältnisse des Caudalrandes, der bei einem rückragendem
Ende des Kammes oft zugleich dessen Ventralrand ist, auseinander setzen zu können, müssen
wir den Rand des Neuraldaches mitbetrachten. Dieser ist stets deutlich dorsal convex und
meist auch in der Längsrichtung eben bis etwas concav, seltener, z. B. Ailurus 1, Cryptoprocta | |
Zorilla lybica 1 Taf. III Fig. 12 nicht concav. Er endet in der Regel auf dem Medianrande
der postzygapophysen, ist aber hier meist so gerundet und dick, dass er fast deren ganze
Dorsalseite einnimmt, z. B. Mydaus 1 Taf. III Fig. 4., wobei dann nicht selten der Rand zuletzt
als kleine Kante etwas nach unten vorn auf dem Lateralrande der Gelenkfortsätze ausläuft, z. B.
Canis lupus Bl. C. PI. IX, Icticyon 1 Taf. IV Fig. 9. Häufig sind seine Enden aber noch durch
<iie später besonders zu besprechenden hyperapophysen verstärkt, z. B. Suricata 1 Taf. II Fig. 7,.
in ändern Fällen allerdings sind diese in der Mitte der Länge des Dachrandes als Verdickungen,
Ecken oder Höcker vorhanden, z. B. Zorilla lybica 1 Taf. III Fig. 12, Icticyon 1
Taf. IV Fig. 9.
Im einfachsten Falle nun ist der Kamm hinten hoch, aber nicht oder nur sehr wenig
verdickt und sein Ende ragt nicht rückwärts vor, dann fällt sein einfacher scharfer oder eben
stumpfer Caudalrand meist eben concav ziemlich senkrecht oder nur eben nach vorn zur Mediane
des Dachrandes, der scharf oder eben stumpf, am Medianrand der postzygapophysen endet, z. B.
Ailurus 1, Zorilla lybica 1 Taf. III Fig. 12. Sehr selten bildet der Caudalrand des Kammes einen
El
nach hinten convexen Tfogeng s . B. Bdeogalp 1. Springt nun das Kammende hinten vor, so
verläuft dieser Rand natürlich mehr oder weniger nach vorn, wie es meist der Fall ist, z. B.
Genetta |;|2, Suricata dl/Taf. TI Fig.:?; I'rocyon 1, Nasua, Taf. II Fig. 19.
Der auf den postzygapophysen meist verdickt endende Dachrand ist nun häufig in seiner
ganzenyLänge stärker verdickt, es befmdet sich dann an ihm. eine rauhe, etwas, vertiefte Fläche,
welche nach hinten unten oder,fast nur nach hinten sieht;; ¿deren Dorsalrand ist meist mehr
oder weniger scharf, ventral: ist sie bald deutlich Von der Decke des can. vert. abgegrenzt,
z. B, Fehs, Taf. I Figj 3 0 , bald kaum, z.- B. Nasua, Tafu H '.Fig- 19, wobei sie in letzterem Fall
hauptsächlich nach unten sieht. Ist nun der Kamm an seiner Basis, z. B. Felis catus, planiceps 9
oeier biSr; zu seinem Oberrande verdickt, z. B. meiste Felidae, Canidae, Ursidae, Hyaena, Pro-
teles, so wird sein Caudalrand auch breit und die rauhe Fläche dehnt sich auf ihn aus, indem
sie bald nach hinten, z. B. Cacisilcticy.on ipStf. IV. Fig. 8, 9, Hyaena brunnea 2 selten ein
wenig nach oben, z. B. Proteles 1 Taf. I Fig. H, häufig etwas, z. B. Felis concolor 11 Taf. I
l'ig- .ülfeer ziemlich nach unten sieht, z. B. Cynaelurus Taf. I Fig. 9. Sie ist median fast stets
eingesenkt, manchmal hier mit einer Kante versehen, z. B. CanisvuJpes 5a.
Ihre Seitenränder, welchii-in den dorsalen Dachhintorrand übergehen, sind meist scharf,
ihr Übergang in den Dachrand ist öfters ein sehr allmähliger, gz. B. Proteles 1 Taf. I Fig. 8,
Hyaena, Bl. H. Plc-TV. Sie fallen von den. oberen Ecken des verbreiterten Kammendes, die
manchmal ein wenig sd e r etwig. verdickt nach aussen hinten vprspringen, z. B. Cynaelurus
guttatus 1 Taf. I Fig. 9, Hyaena. 11. H. PI. IV, nach unten, meist ein wenig nach aussen und
mehr oder weniger vorn. Ist das: K:tmtncr.'dtf*s,ehr nieder und vor dem Dachende gelegen, so
sind, sic natürlich etwas nach hinten: gerichtet, z. B. Otocyon. Bl. C. PI. IX.
graäHfi. vettebra cervicalis.
Der proefäspin. ist hier stark von dem. des. opistropheus verschieden, vor allem nie sehr
stark, meist zuerst ganz schwach, dabei in der Regel schlank, stets einfach und unvermittelt
aus dem Neuraldach aufsteigend. Der Rostralrand ist wie an allen weiteren Dorr.fort
Sätzen- einfach und scharfrandig, der Caudalrand meist auch, z. B. Felis domestica 1, Lutra
lutra 1, la. Am;?^ v. e, ist der letztere jedoch meist:stumpf,gfters auch «chon am #, v. o., z. B.
Genetta, Viverra, seltener am Ö.—7. v. c., z.§|| Cynaelurus 1, 2. noch seltener am 3. und 4. v. c.,
z. B.laradoxurus 1. Bei Canis v u lpÄ5a ist er am 6. und 7, in der Mitte der Höhe etwas
abgestumpft und bei Viverra 1, 2 am 3gVjni;S. v. «^stampf und in zw e item Dachkerben-
Rand entlang laufende Leisten gegabelt, auch am 7. v. o. sind selten einmal nahe der Basis
zwei solche Leistchen, z. B. Mustela martes 2g, -
Während am 3. v. c.Ji^r RfStralrand in der Regel hinter dem Dachrande entspringt,
ist dies an den folgenden nur ziemlich leiten der Fall, ,z. B. 4.—7. v. c. Mellivora I, Zorilla
lybica 1 Taf. III Fig.-$ ¿5 . v. c. Cuon javanicus 2a Taf. W|pigc3#:; der Caudalrand ist manchmal
am 4.-i#i v. c. auch nicht ganz am Dachende, z. B. meistöä,Canidae. Darnach und je nach
der Dachlänge sind die Domfortsätze natürlich verschieden breit, z. B. relativ schlank bei
Procyonidae, breit bei Proteles 1, Bl. C. PI. III, Lutra 1, la, 2, Bl. M. PI. V, IX. Der Domfortsatz
des 3. vv-.e-, .ist ziemlich häufig relativ breit und oben %eit gerundet,¡-.z. B. Felis leo Bl.
F. PI. I, onpa Bl. F. PI. II, aber fast häufiger läuft er, wie meist die folgenden, gegen das Ende
mehr oder minder spitz zu, z. B. Gulo Bl. M. PI. III. Der 4. und 5. Dornfortsatz ist meist am
Zoologica. Heft 36. S