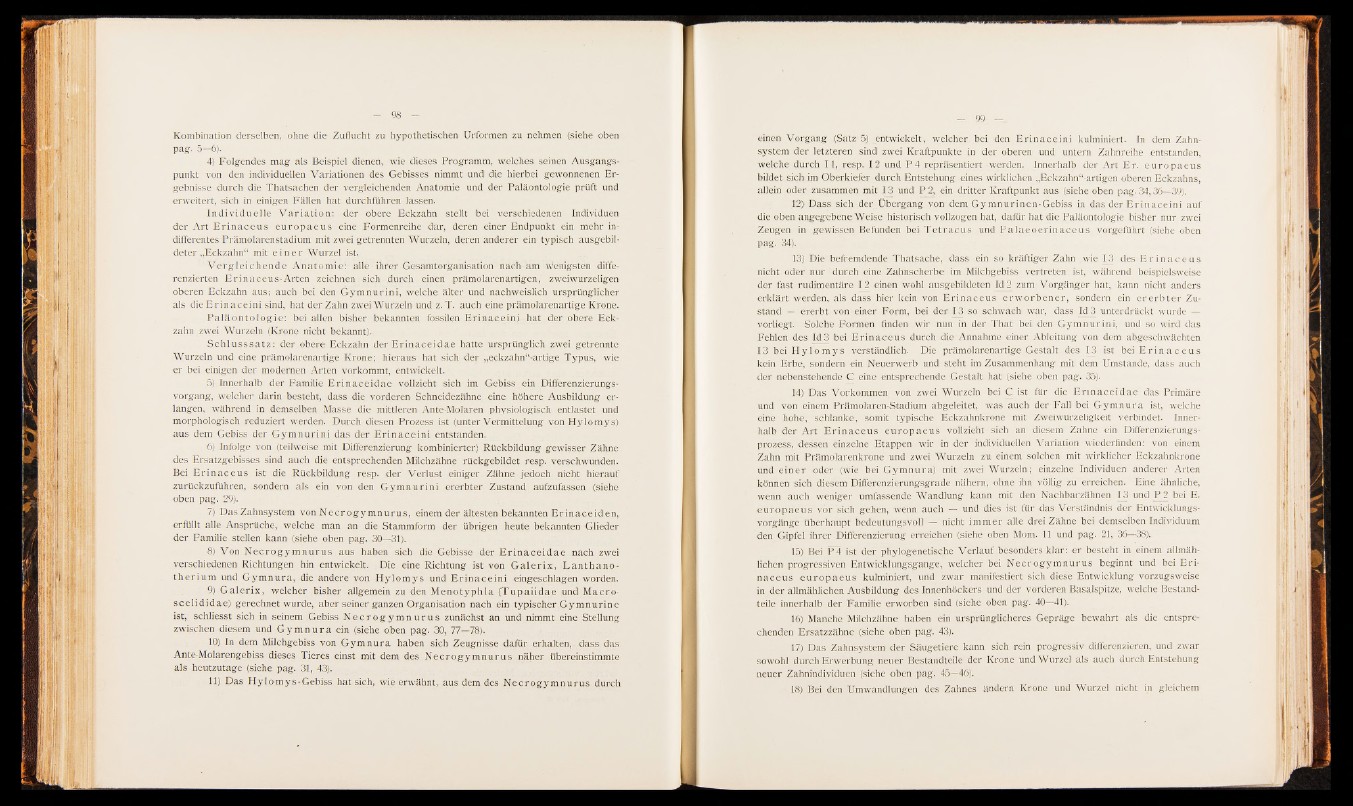
Kombination derselben, ohne die Zuflucht zu hypothetischen Urformen zu nehmen (siehe oben
pag. 5—6).
4) Folgendes mag als Beispiel dienen, wie dieses Programm, welches seinen Ausgangspunkt
von den individuellen Variationen des Gebisses nimmt und die hierbei gewonnenen Ergebnisse
durch die Thatsachen der vergleichenden Anatomie und der Paläontologie prüft und
erweitert, sich in einigen Fällen hat durchführen lassen.
In d iv id u e lle V a ria tio n : der obere Eckzahn stellt bei verschiedenen Individuen
der Art E rin a c e u s e u ro p a e u s eine Formenreihe dar, deren einer Endpunkt ein mehr indifferentes
Prämolarenstadium mit zwei getrennten Wurzeln, deren anderer ein typisch ausgebildeter
„Eckzahn“ mit e in e r Wurzel ist.
V e rg le ich e n d e Anatomie: alle ihrer Gesamtorganisation nach am wenigsten differenzierten
Erinaceus-Arten zeichnen sich durch einen prämolarenartigen, zweiwurzeligen
oberen Eckzahn aus; auch bei den Gymnurini, welche älter und nachweislich ursprünglicher
als die E rin a c e in i sind, hat der Zahn zwei Wurzeln und z. T. auch eine prämolarenartige Krone.
P a lä o n to lo g ie : bei allen bisher bekannten fossilen E rin a c e in i hat der obere Eckzahn
zwei Wurzeln (Krone nicht bekannt)..
S c h lu s s s a tz : der obere Eckzahn der E rin a c e id a e hatte ursprünglich zwei getrennte
Wurzeln und eine prämolarenartige Krone; hieraus hat sich der „eckzahn“-artige Typus, wie
er bei einigen der modernen Arten vorkommt, entwickelt.
5) Innerhalb der Familie E rin a c e id a e vollzieht sich im Gebiss ein Differenzierungsvorgang,
welcher darin besteht, dass die vorderen Schneidezähne eine höhere Ausbildung erlangen,
während in demselben Masse die mittleren Ante-Molaren physiologisch entlastet und
morphologisch reduziert werden. Durch diesen Prozess ist (unter Vermittelung von Hylomys)
aus dem Gebiss der Gymnurini das der E rin a c e in i entstanden.
6) Infolge von (teilweise mit Differenzierung kombinierter) Rückbildung gewisser Zähne
des Ersatzgebisses sind auch die entsprechenden Milchzähne rückgebildet resp. verschwunden.
Bei E rin a c e u s ist die Rückbildung resp. der Verlust einiger Zähne jedoch nicht hierauf
zurückzuführen, sondern als ein von den G ym nurini ererbter Zustand aufzufassen (siehe
oben pag. 29).
7) Das Zahnsystem von N e c ro g ym n u ru s , einem der ältesten bekannten E rin a c e id en ,
erfüllt alle Ansprüche, welche man an die Stammform der übrigen heute bekannten Glieder
der Familie stellen kann (siehe oben pag. 30—31).
8) Von N e c ro g ym n u ru s aus haben sich die Gebisse der E rin a c e id a e nach zwei
verschiedenen Richtungen hin entwickelt. Die eine Richtung ist von G a le rix , L an th an o -
th e rium und Gymnura, die andere von Hy lom y s und E rin a c e in i eingeschlagen worden.
9) G a le rix , welcher bisher allgemein zu den Menotyphla (T u p aiid ae und Macro-
sc e lid id ae ) gerechnet wurde, aber seiner ganzen Organisation nach ein typischer Gymnurine
ist, schliesst sich in seinem Gebiss N e c r o g y m n u r u s zunächst an und nimmt eine Stellung
zwischen diesem und G ym n u r a ein (siehe oben pag. 30, 77—78).
10) In dem Milchgebiss von Gymnura haben sich Zeugnisse dafür erhalten, dass das
Ante-Molarengebiss dieses Tieres einst mit dem des N e c ro g ym n u ru s näher übereinstimmte
als heutzutage (siehe pag. 31, 43).
11) Das Hylomys-Gebiss hat sich, wie erwähnt, aus dem des N e c ro g ym n u ru s durch
einen Vorgang (Satz 5). entwickelt, welcher bei den E rin a c e in i kulminiert. In dem Zahnsystem
der letzteren sind zwei Kraftpunkte in der oberen und untern Zahnreihe entstanden,
welche durch I I, resp. 12 und P 4 repräsentiert werden. Innerhalb der Art Er. e u ro p a e u s
bildet sich im Oberkiefer durch Entstehung eines wirklichen „Eckzahn“-artigen oberen Eckzahns,
allein oder zusammen mit 13 und P2, ein dritter Kraftpunkt aus (siehe oben pag.34,36—39).
12) Dass sich der Übergang von dem Gymnurinen-Gebiss in das der E rin a c e in i auf
die oben angegebene Weise historisch vollzogen hat, dafür hat die Paläontologie bisher nur zwei
Zeugen in gewissen Befunden bei T e tra c u s und P a la e o e rin a c e u s vorgeführt (siehe oben
pag. 34).
13) Die befremdende Thatsache, dass ein so kräftiger Zahn .wie 13 des E r in a c e u s
nicht oder nur durch eine Zahnscherbe im Milchgebiss vertreten ist, während beispielsweise
der fast rudimentäre 12 einen wohl ausgebildeten Id 2 zum Vorgänger hat, kann nicht anders
erklärt werden, als dass hier kein von E rin a c eu s e rw o rb en e r, sondern ein e r e rb te r Zustand
— ererbt von einer Form, bei der 13 so schwach war, dass Id 3 unterdrückt wurde —
vorliegt. Solche Formen finden wir nun in der That beiden Gymnurini; und so wird das
Fehlen des Id 3 bei E rin a c e u s durch die Annahme einer Ableitung von dem abgeschwächten
13 bei H y lom y s verständlich. Die prämolarenartige Gestalt des 13 ist bei E r in a c e u s
kein Erbe, sondern ein Neuerwerb und steht im Zusammenhang mit dem Umstande, dass auch
der nebenstehende C eine entsprechende Gestalt hat (siehe oben pag. 35).
14) Das Vorkommen von zwei Wurzeln bei C ist für die E rin a c e id a e das Primäre
und von einem Prämolaren-Stadium abgeleitet, was auch der-Fall bei Gym nura ist, welche
eine hohe, schlanke, somit typische Eckzahnkrone mit Zweiwurzeligkeit verbindet. Innerhalb
der Art E rin a c e u s eu ro p a e u s vollzieht sich an diesem Zahne ein Differenzierungsprozess,
dessen einzelne Etappen wir in der individuellen Variation wiederfinden: von einem
Zahn mit Prämolarenkrone und zwei Wurzeln zu einem solchen mit wirklicher Eckzahnkrone
und e in e r oder (wie bei Gymnura) mit zwei Wurzeln; einzelne Individuen anderer Arten
können sich diesem Differenzierungsgrade nähern, ohne ihn völlig zu erreichen. Eine ähnliche,
wenn auch weniger umfassende Wandlung kann mit den Nachbarzähnen 13 und P2 bei E.
e u ro p a e u s vor sich gehen, wenn auch — und dies ist für das Verständnis der Entwicklungsvorgänge
überhaupt bedeutungsvoll — nicht immer alle drei Zähne bei demselben Individuum
den Gipfel ihrer Differenzierung erreichen (siehe oben Mom. 11 und pag. 21; 36—38).
15) Bei P 4 ist der phylogenetische Verlauf besonders klar: er besteht in einem allmählichen
progressiven Entwicklungsgänge, welcher bei N e cro g ym n u ru s beginnt und bei E rin
a ceu s e u ro p a e u s kulminiert, und zwar manifestiert sich diese Entwicklung vorzugsweise
in der allmählichen Ausbildung des Innenhöckers und der vorderen Basalspitze, welche Bestandteile
innerhalb der Familie erworben sind (siehe oben pag. 40—41).
16) Manche Milchzähne haben ein ursprünglicheres Gepräge bewahrt als die entsprechenden
Ersatzzähne (siehe oben pag. 43),
17) Das Zahnsystem der Säugetiere kann sich rein progressiv differenzieren, und zwar
sowohl durch Erwerbung neuer Bestandteile der Krone und Wurzel als auch durch Entstehung
neuer Zahnindividuen (siehe oben pag. 45—46).
18) Bei den Umwandlungen des Zahnes ändern Krone und Wurzel nicht in gleichem